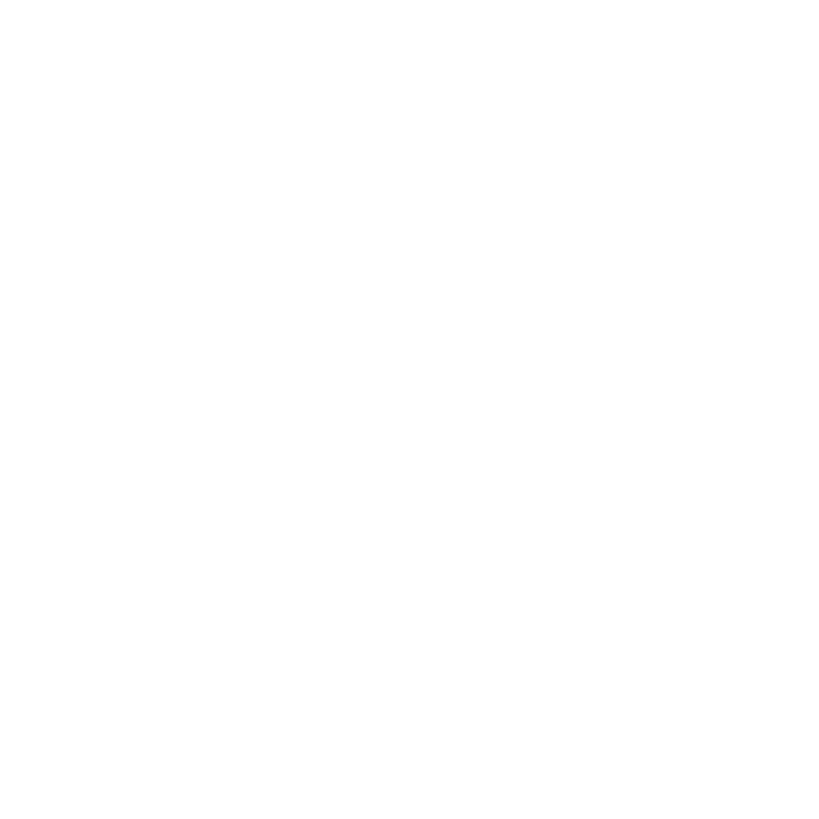Amtstierärztlicher Dienst
Ausgabe 4/2024
Amtstierärztlicher Dienst
Ausgabe 4/2024
Plattform zur bundesweiten Sammlung von Schulungsmaterialien für die Tätigen in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Eine Sammlung bundesweit verfügbarer Schulungsunterlagen ist auf dem öffentlichen Ordner der AFFL in FIS-VL veröffentlicht worden. Die Notwendigkeit, der Nutzen, der Zugang und die Nutzungsbedingungen werden vorgestellt.
Autor*in:
Dr. Katrin Sassen
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Calenberger Straße 2
30169 Hannover
E-Mail: Katrin.Sassen@ml.niedersachsen.de
Wildbrethygiene in neun Fallgestaltungen
Die Regelungen zur Wildbrethygiene sind komplex und werfen sowohl bei Jagenden als auch bei amtlichem Personal häufig Verständnisfragen auf. Das rheinland-pfälzische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität hat in einer Broschüre ausgewählte Fallgestaltungen rechtlich eingeordnet. Der Beitrag beschreibt die Hintergründe, skizziert die Inhalte der Broschüre und schildert die Einbindung der Jägerschaft.
Autor*in:
Dr. Sven Gierse
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz
Ober-Olmer Straße 17c
55127 Mainz
E-Mail: sven.gierse@web.de und sven.gierse@mkuem.rlp.de
Keine konkrete Gefahr für Rinder in Marokko? – Entscheidungsbesprechung des Urteils des VG Osnabrück vom 23. April 2024 (2 A 201/23)
Es wird dargestellt, warum für alle nach Marokko exportierten Rinder eine konkrete Gefahr besteht, innerhalb eines überschaubaren Zeitraums nach ihrer Ankunft im Bestimmungsland betäubungslos geschächtet zu werden. Dargestellt wird auch, weshalb – neben der Veterinärbehörde, die transportbezogene Untersagungsverfügungen erlassen kann und muss – auch die Bundesregierung als Verordnungsgeber verpflichtet ist, ihre Untätigkeit gegenüber den Bewilligungen von Tiertransporten in Tierschutz-Hochrisikostaaten aufzugeben und eine auf § 12 Abs. 2 Nr. 3 TierSchG beruhende Rechtsverordnung, mit der der Export lebender sog. Nutztiere in Tierschutz-Hochrisikostaaten verboten wird, zu erlassen. Auch wird auf die Vereinbarkeit einer solchen Rechtsverordnung mit dem EU-Recht und dem internationalen Recht eingegangen.
Autor*innen:
Dr. jur. Barbara Felde
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V. (DJGT)
Littenstraße 108
10179 Berlin
E-Mail: b.felde@djgt.de
Dr. med. vet. Alexander Rabitsch
Tierärztliche Praxis
Rosental Waldstraße 13
A-9170 Ferlach
E-Mail: animalwelfare@rabitsch-vet.at
Abwasserbasierte Infektionsepidemiologie – manchmal muss man für Innovationen auch im Trüben fischen
Abwassermonitoring, eine Methodik, um die Zusammensetzung und Qualität von Abwasser zu analysieren, ist eine revolutionäre Methode, deren Ergebnisse es ermöglichen, Einblicke in die öffentliche Gesundheit und Umweltbelastungen auf Ebene einer Gemeinschaft (z. B. Stadt, Kaserne, Schiff) zu gewinnen, die durch herkömmliche Verfahren nicht möglich wären. Die COVID-19-Pandemie hat das Potenzial dieser Technik deutlich gemacht, indem sie eine kosteneffiziente, umfassende und zeitnahe Überwachung der Virusverbreitung ermöglichte. Trotz der Herausforderungen in Bezug auf Dateninterpretation, Spezifität und Ressourcenaufwand bietet das Abwassermonitoring eine vielversprechende Perspektive für die zukünftige Überwachung und Kontrolle von Infektions-krankheiten sowie für die Bewertung von Umweltbelastungen. Dies ist damit ganz im Sinne des sog. One Health-Ansatzes der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in dem verschiedene Sektoren zusammenarbeiten, um bessere Ergebnisse in Bezug auf die öffentliche Gesundheit zu erreichen. Abgeleitet aus diesen Möglichkeiten im Bereich der zivilen Ge-sundheitsüberwachung zeigte sich auch, dass im militärischen Kontext von Einsätzen der Gesundheitsschutz aller Soldatinnen und Soldaten (sog. Force Health Protection (FHP)) enorm vom Abwassermonitoring bzw. der abwasserbasierten Infektionsüberwachung auf SARS-CoV-2 profitieren konnte und kann. Der Sanitätsdienst der Bundeswehr – federführend durch das Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr (KdoSanDstBw), Referat VI 2, Gesundheitsüberwachung und -berichterstattung – hat seit 2020 auch im Rahmen der zivilmilitärischen Zusam-menarbeit (ZMZ) in zahlreichen Projekten viele wertvolle Erfahrungen sammeln und die Bedeutung und Vorteile der Methode ständig weiterentwickeln und erweitern können. Die weltweit erstmalige Durchführung bzw. Anwendung eines SARS-CoV- 2-Abwassermonitorings in einem Auslandseinsatz in einem Feldlager in Gao, Mali, von 2021 bis 2023 ist nur ein Beispiel dafür. Mittlerweile ist die Bundeswehr durch KdoSanDstBw VI 2 und ausgewählten Diagnostikeinrichtungen im Bundeswehr-zentralkrankenhaus Koblenz (Abteilung XXIB) und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr (InstMikro- BioBw), München, sowohl im Betrieb als auch bei der Weiterentwicklung der abwasserbasierten epidemiologischen Überwachung von Infektionserregern inhaltlich, fachlich und methodisch ein national und international anerkannter Partner. Damit verbunden ist auch eine wichtige konzeptionelle Weiterentwicklung der Fähigkeit Gesundheitsschutz/FHP in der Bundeswehr im Allgemeinen bzw. auch der sog. Zelle Gesundheitsschutz/ FHP der zukünftig in Litauen stationierten deutschen Brigade (Brig LTU), die dann das Element des Abwassermonitorings von Beginn an enthalten soll. Das abwasserbasierte Monitoring auf Infektionserreger hat somit die einzigartige Qualität Epidemiologie vorausschauend, regelmäßig, aktuell und populationsbezogen zu erfassen und damit sowohl präventiv als auch im Bereich der Bekämpfung bzw. Eindämmung von Geschehnissen im Rahmen des Aus-bruchsmanagements eine neue Qualitätsebene des Gesund-heitsschutzes/ FHP unter Berücksichtigung des One Health- Ansatzes der WHO zu ermöglichen.
Autor*innen:
Dimitrios Frangoulidis, Rudolf Markt, Daniela Barth, Matthias Frank, Gerd Großmann, Alexander Ziegler, Katalyn Roßmann, Carsten Balczun, Sebastian Albrecht
Priv.-Doz. Dr. med. Dimitrios Frangoulidis
Oberfeldarzt (OFArzt) Sanitätsakademie der Bundeswehr Abt. MI2 / Surveillance / MN FHP Nexus
Dachauer Straße 128
80637 München
Gebäude 12 Etage UG Raum 017
E-Mail: DimitriosFrangoulidis@Bundeswehr.org SanAkBwMI2@Bundeswehr.org
Management von brandverletzten Rindern in der Praxis
Die erfolgreiche Behandlung von Brandverletzungen bei Rindern ist in der Praxis oft sehr schwierig. Vor allem in der ersten Phase eines Stallbrandes ist die Situation meistens unübersichtlich und chaotisch (Phase der Erkundung). Um diesen Schadensfall sicher abzuarbeiten, ist es wichtig, sich mit den Einsatzkräften vor Ort abzusprechen. Die Entscheidung, wann und ob die Tiere evakuiert werden, treffen immer die Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Die Triage von verletzten Rindern richtet sich nach dem Grad der Verbrennung und der verbrannten Körperoberfläche. Die Erste Hilfe kann von Laien durchgeführt werden und umfasst in erster Linie die Küh-lung der Verbrennungen mit handwarmem und sauberem Wasser. Die Akuttherapie umfasst eine angemessene Analgesie, Antibiose von ausreichender Dauer und eine angemessene Wundversorgung; bei brandverletzten Kälbern kann eine Flüssigkeitssubstitution sinnvoll sein. Mit Komplikationen wie dem Auftreten von Inhalationstraumata oder Kohlenmonoxidvergif-tungen ist zu rechnen. Von einer Schlachtung frisch brandverletzter Tiere ist abzusehen.
Autor*innen:
Eva Zeiler, Florian Diel-Loose, Carola Sauter-Louis, Tamara Göttl, Veronika Haselbeck, Elke Rauch, Britta Wallner
Prof. Dr. Dr. Eva Zeiler
Tierproduktionssysteme in der ökologischen Landwirtschaft
Fakultät für nachhaltige Agrar- und Energiesysteme, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Am Staudengarten 1
85354 Freising
E-Mail: eva.zeiler@hswt.de
West-Nil-Virusinfektion bei Pferden – eine Übersicht
Dieser Artikel stellt eine Übersicht zur West-Nil-Virusinfektion bei Pferden dar, die seit dem ersten laborbestätigten Infektionsfall eines Pferdes in Deutschland im Jahr 2018 und der darauffolgenden Zunahme an Infektionszahlen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der Ursprung des West-Nil-Virus liegt in Uganda im West-Nil-Distrikt, wo das Virus 1937 erstmals bei einer Frau isoliert wurde. Mittels in Afrika infizierter Zugvögel gelangte das Virus nach Europa und verbreitete sich über süd-und osteuropäische Länder nach Deutschland. Die Übertragung des Virus als geschlossener Zyklus erfolgt von Stechmücke zu Vogel und wieder zu Stechmücke. Pferde sind Fehlwirte und können aufgrund einer zu geringen Viruslast keine Mücken und/oder andere Pferde infizieren. Das West-Nil-Virus gelangt nach einem Stich in die Haut durch den Speichel der Mücke in den Organismus des Pferdes und löst dort Entzündungen aus. Das Virus besitzt zudem die Fähigkeit, über verschiedene Mechanismen zum zentralen Nervensystem zu gelangen und dort Schädigungen auszulösen. Krankheitsanzeichen treten bei 10 % der infizierten Pferde auf und sind sehr variabel und unspezifisch. Bei schwereren Verläufen können eine Vielzahl von neurologischen Auffälligkeiten festgestellt werden. Eine Diagnose des West-Nil-Virus erfolgt in erster Linie über einen indirekten Erregernachweis (ELISA). Antikörpernachweise müssen aufgrund von Kreuzreaktionen mit anderen Flaviviren über einen Virusneutralisationstest abgesichert werden. Differenzialdiagnostisch kommen hauptsächlich Krankheiten infrage, die neurologische Ausfallerscheinungen hervorrufen, unter anderem verschiedene virale und bakterielle Erkrankungen, jedoch auch Intoxikationen oder Traumata. Für die Prophylaxe einer West-Nil-Virusinfektion gibt es die Möglichkeiten der Anpassungen im Haltungsmanagement durch Mückenschutz- und Mückenbekämpfungsmaßnahmen sowie die der Impfung gegen das West-Nil-Virus. Die Impfung schützt jedoch nicht vor einer Infektion, sie mildert gegebenenfalls den Verlauf. Therapeutisch können nur die Symptome gelindert werden. Eine West-Nil- Virusinfektion bei Tieren sowie ein entsprechender Verdacht ist anzeigepflichtig und muss unverzüglich beim zuständigen Veterinäramt angezeigt werden. Experten scheinen sich einig, dass sich das West-Nil-Virus weiter in Deutschland verbreiten wird. Aufgrund des Klimawandels mit längeren Sommern und milderen Wintern finden Stechmücken zunehmend geeignetere Bedingungen, um das Virus weiterzugeben.
Autor*in:
Nathalie Christ
Gaswerkstraße 3
74336 Brackenheim
E-Mail: nathalie.christ@gmx.de
Entscheidender Beitrag zur Kontrolle von antibio-tikaresistenten Keimen sowie Zoonoseerregern in der Geflügelhaltung
Dr. Anika Friese, For-scherin am Institut für Tier- und Umwelthy-giene der Freien Universität Berlin, erhält in diesem Jahr den mit einer Urkunde und einem Preisgeld in Hö-he von 10.000 Euro versehenen Stockmeyer-Wissenschaftspreis für ihre Habilitationsschrift über zoonotische und antibiotikaresistente Bakterien bei Masthuhn und -pute.
Heinrich-Stockmeyer-Stiftung
Parkstraße 44–46
49214 Bad Rothenfelde
Telefon: 5424/299-144
E-Mail: info@heinrich-stockmeyer-stiftung.de
www.heinrich-stockmeyer-stiftung.de
Tierschutz auf dem Gnadenhof – Adressaten tierschutzrechtlicher Anordnungen
Beschluss des VG Koblenz vom 26. Februar 2024 (3 L 1074/23.KO)
Das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz hat entschieden, dass eine Anordnung der zuständigen Tierschutzbehörde gegenüber der Betreiberin eines sogenannten Gnadenhofs für Hunde, ihren Tierbestand wegen erheblicher tierschutzrechtlicher Verstöße auf maximal fünf Hunde zu reduzieren, rechtmäßig war. Die auf § 16a des Tierschutzgesetzes (TierSchG) gestützte Anordnung sei auch ermessensgerecht.
Autor*in:
Thorsten Bludau
Beigeordneter
Am Mittelfelde 169
30169 Hannover
Telefon: 0511 87953-21
E-Mail: bludau@nlt.de
Tierschutzrecht: Zuviel ist zuviel! – OVG Rheinland-Pfalz (Az.: 7 B 10232/24.OVG)
Das OVG Rheinland-Pfalz hat auch in zweiterInstand gegen die Betreiberin eine „Gnadenhofes“ entschieden, der das Veterinäramt die drastische Reduzierung ihres Tierbestandes aufgebe hatte.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Zum Verhältnis von Straf- und Verwaltungsverfahren – und: Zwei Verstöße reichen für ein Tierhaltungsverbot!
OVG des Saarlandes (Az.: 2 D 40/24 und 2 D 41/24)
Das OVG des Saarlandes (Az.: 2 D 40/24 und 2 D 41/24) hatte sich mit der Anordnung eines Tierhaltungs- und Betreuungsverbotes zu befassen, das mit der Anordnung einer Wegnahmeduldung sowie der Kostentragungspflicht für die Unterbringung des Tieres verbunden war. Zugleich gab es ein Strafverfahren gegen den früheren Tierhalter, das mit einer Einstellung nach § 153a StPO gegen Zahlung einer Geldauflage endete.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Entscheidung zur Rechtmäßigkeit einer Wegnahme – VG Bayreuth (Az.: B 1 K 21.1221)
Das VG Bayreuth (Az.: B 1 K 21.1221) hatte sich mit einem veterinäramtlichen Bescheid dahingehend zu befassen, dass der Klägerin der Verkauf bzw. die Abgabe ihrer Pferde aufgegeben sowie die Pferdehaltung untersagt wurde.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Neues vom Wolf: Der EuGH urteilt für den Artenschutz – der Streit um die Bayerische Wolfsverordnung geht weiter – Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht
Weniger die Interessen der Schafhalter als vielmehr die Interessen des Artenschutzes finden Berücksichtigung bei einigen aktuellen Entscheidungen.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Zur Kostenerstattung bei der tierschutzrechtlichen Wegnahme von Tieren – VG Neustadt / Weinstraße (Az.: 2 K 1013/21.NW)
Das VG Neustadt / Einstraße hatte sich mit der Frage zu befassen, in welcher Weise die Kosten, die eine Behörde aufgrund der Wegnahme von Tieren gegen deren früheren Halter geltend macht, erstattet werden können.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Plattform zur bundesweiten Sammlung von Schulungsmaterialien für die Tätigen in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Eine Sammlung bundesweit verfügbarer Schulungsunterlagen ist auf dem öffentlichen Ordner der AFFL in FIS-VL veröffentlicht worden. Die Notwendigkeit, der Nutzen, der Zugang und die Nutzungsbedingungen werden vorgestellt.
Autor*in:
Dr. Katrin Sassen
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Calenberger Straße 2
30169 Hannover
E-Mail: Katrin.Sassen@ml.niedersachsen.de
Wildbrethygiene in neun Fallgestaltungen
Die Regelungen zur Wildbrethygiene sind komplex und werfen sowohl bei Jagenden als auch bei amtlichem Personal häufig Verständnisfragen auf. Das rheinland-pfälzische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität hat in einer Broschüre ausgewählte Fallgestaltungen rechtlich eingeordnet. Der Beitrag beschreibt die Hintergründe, skizziert die Inhalte der Broschüre und schildert die Einbindung der Jägerschaft.
Autor*in:
Dr. Sven Gierse
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz
Ober-Olmer Straße 17c
55127 Mainz
E-Mail: sven.gierse@web.de und sven.gierse@mkuem.rlp.de
Keine konkrete Gefahr für Rinder in Marokko? – Entscheidungsbesprechung des Urteils des VG Osnabrück vom 23. April 2024 (2 A 201/23)
Es wird dargestellt, warum für alle nach Marokko exportierten Rinder eine konkrete Gefahr besteht, innerhalb eines überschaubaren Zeitraums nach ihrer Ankunft im Bestimmungsland betäubungslos geschächtet zu werden. Dargestellt wird auch, weshalb – neben der Veterinärbehörde, die transportbezogene Untersagungsverfügungen erlassen kann und muss – auch die Bundesregierung als Verordnungsgeber verpflichtet ist, ihre Untätigkeit gegenüber den Bewilligungen von Tiertransporten in Tierschutz-Hochrisikostaaten aufzugeben und eine auf § 12 Abs. 2 Nr. 3 TierSchG beruhende Rechtsverordnung, mit der der Export lebender sog. Nutztiere in Tierschutz-Hochrisikostaaten verboten wird, zu erlassen. Auch wird auf die Vereinbarkeit einer solchen Rechtsverordnung mit dem EU-Recht und dem internationalen Recht eingegangen.
Autor*innen:
Dr. jur. Barbara Felde
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V. (DJGT)
Littenstraße 108
10179 Berlin
E-Mail: b.felde@djgt.de
Dr. med. vet. Alexander Rabitsch
Tierärztliche Praxis
Rosental Waldstraße 13
A-9170 Ferlach
E-Mail: animalwelfare@rabitsch-vet.at
Abwasserbasierte Infektionsepidemiologie – manchmal muss man für Innovationen auch im Trüben fischen
Abwassermonitoring, eine Methodik, um die Zusammensetzung und Qualität von Abwasser zu analysieren, ist eine revolutionäre Methode, deren Ergebnisse es ermöglichen, Einblicke in die öffentliche Gesundheit und Umweltbelastungen auf Ebene einer Gemeinschaft (z. B. Stadt, Kaserne, Schiff) zu gewinnen, die durch herkömmliche Verfahren nicht möglich wären. Die COVID-19-Pandemie hat das Potenzial dieser Technik deutlich gemacht, indem sie eine kosteneffiziente, umfassende und zeitnahe Überwachung der Virusverbreitung ermöglichte. Trotz der Herausforderungen in Bezug auf Dateninterpretation, Spezifität und Ressourcenaufwand bietet das Abwassermonitoring eine vielversprechende Perspektive für die zukünftige Überwachung und Kontrolle von Infektions-krankheiten sowie für die Bewertung von Umweltbelastungen. Dies ist damit ganz im Sinne des sog. One Health-Ansatzes der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in dem verschiedene Sektoren zusammenarbeiten, um bessere Ergebnisse in Bezug auf die öffentliche Gesundheit zu erreichen. Abgeleitet aus diesen Möglichkeiten im Bereich der zivilen Ge-sundheitsüberwachung zeigte sich auch, dass im militärischen Kontext von Einsätzen der Gesundheitsschutz aller Soldatinnen und Soldaten (sog. Force Health Protection (FHP)) enorm vom Abwassermonitoring bzw. der abwasserbasierten Infektionsüberwachung auf SARS-CoV-2 profitieren konnte und kann. Der Sanitätsdienst der Bundeswehr – federführend durch das Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr (KdoSanDstBw), Referat VI 2, Gesundheitsüberwachung und -berichterstattung – hat seit 2020 auch im Rahmen der zivilmilitärischen Zusam-menarbeit (ZMZ) in zahlreichen Projekten viele wertvolle Erfahrungen sammeln und die Bedeutung und Vorteile der Methode ständig weiterentwickeln und erweitern können. Die weltweit erstmalige Durchführung bzw. Anwendung eines SARS-CoV- 2-Abwassermonitorings in einem Auslandseinsatz in einem Feldlager in Gao, Mali, von 2021 bis 2023 ist nur ein Beispiel dafür. Mittlerweile ist die Bundeswehr durch KdoSanDstBw VI 2 und ausgewählten Diagnostikeinrichtungen im Bundeswehr-zentralkrankenhaus Koblenz (Abteilung XXIB) und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr (InstMikro- BioBw), München, sowohl im Betrieb als auch bei der Weiterentwicklung der abwasserbasierten epidemiologischen Überwachung von Infektionserregern inhaltlich, fachlich und methodisch ein national und international anerkannter Partner. Damit verbunden ist auch eine wichtige konzeptionelle Weiterentwicklung der Fähigkeit Gesundheitsschutz/FHP in der Bundeswehr im Allgemeinen bzw. auch der sog. Zelle Gesundheitsschutz/ FHP der zukünftig in Litauen stationierten deutschen Brigade (Brig LTU), die dann das Element des Abwassermonitorings von Beginn an enthalten soll. Das abwasserbasierte Monitoring auf Infektionserreger hat somit die einzigartige Qualität Epidemiologie vorausschauend, regelmäßig, aktuell und populationsbezogen zu erfassen und damit sowohl präventiv als auch im Bereich der Bekämpfung bzw. Eindämmung von Geschehnissen im Rahmen des Aus-bruchsmanagements eine neue Qualitätsebene des Gesund-heitsschutzes/ FHP unter Berücksichtigung des One Health- Ansatzes der WHO zu ermöglichen.
Autor*innen:
Dimitrios Frangoulidis, Rudolf Markt, Daniela Barth, Matthias Frank, Gerd Großmann, Alexander Ziegler, Katalyn Roßmann, Carsten Balczun, Sebastian Albrecht
Priv.-Doz. Dr. med. Dimitrios Frangoulidis
Oberfeldarzt (OFArzt) Sanitätsakademie der Bundeswehr Abt. MI2 / Surveillance / MN FHP Nexus
Dachauer Straße 128
80637 München
Gebäude 12 Etage UG Raum 017
E-Mail: DimitriosFrangoulidis@Bundeswehr.org SanAkBwMI2@Bundeswehr.org
Management von brandverletzten Rindern in der Praxis
Die erfolgreiche Behandlung von Brandverletzungen bei Rindern ist in der Praxis oft sehr schwierig. Vor allem in der ersten Phase eines Stallbrandes ist die Situation meistens unübersichtlich und chaotisch (Phase der Erkundung). Um diesen Schadensfall sicher abzuarbeiten, ist es wichtig, sich mit den Einsatzkräften vor Ort abzusprechen. Die Entscheidung, wann und ob die Tiere evakuiert werden, treffen immer die Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Die Triage von verletzten Rindern richtet sich nach dem Grad der Verbrennung und der verbrannten Körperoberfläche. Die Erste Hilfe kann von Laien durchgeführt werden und umfasst in erster Linie die Küh-lung der Verbrennungen mit handwarmem und sauberem Wasser. Die Akuttherapie umfasst eine angemessene Analgesie, Antibiose von ausreichender Dauer und eine angemessene Wundversorgung; bei brandverletzten Kälbern kann eine Flüssigkeitssubstitution sinnvoll sein. Mit Komplikationen wie dem Auftreten von Inhalationstraumata oder Kohlenmonoxidvergif-tungen ist zu rechnen. Von einer Schlachtung frisch brandverletzter Tiere ist abzusehen.
Autor*innen:
Eva Zeiler, Florian Diel-Loose, Carola Sauter-Louis, Tamara Göttl, Veronika Haselbeck, Elke Rauch, Britta Wallner
Prof. Dr. Dr. Eva Zeiler
Tierproduktionssysteme in der ökologischen Landwirtschaft
Fakultät für nachhaltige Agrar- und Energiesysteme, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Am Staudengarten 1
85354 Freising
E-Mail: eva.zeiler@hswt.de
West-Nil-Virusinfektion bei Pferden – eine Übersicht
Dieser Artikel stellt eine Übersicht zur West-Nil-Virusinfektion bei Pferden dar, die seit dem ersten laborbestätigten Infektionsfall eines Pferdes in Deutschland im Jahr 2018 und der darauffolgenden Zunahme an Infektionszahlen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der Ursprung des West-Nil-Virus liegt in Uganda im West-Nil-Distrikt, wo das Virus 1937 erstmals bei einer Frau isoliert wurde. Mittels in Afrika infizierter Zugvögel gelangte das Virus nach Europa und verbreitete sich über süd-und osteuropäische Länder nach Deutschland. Die Übertragung des Virus als geschlossener Zyklus erfolgt von Stechmücke zu Vogel und wieder zu Stechmücke. Pferde sind Fehlwirte und können aufgrund einer zu geringen Viruslast keine Mücken und/oder andere Pferde infizieren. Das West-Nil-Virus gelangt nach einem Stich in die Haut durch den Speichel der Mücke in den Organismus des Pferdes und löst dort Entzündungen aus. Das Virus besitzt zudem die Fähigkeit, über verschiedene Mechanismen zum zentralen Nervensystem zu gelangen und dort Schädigungen auszulösen. Krankheitsanzeichen treten bei 10 % der infizierten Pferde auf und sind sehr variabel und unspezifisch. Bei schwereren Verläufen können eine Vielzahl von neurologischen Auffälligkeiten festgestellt werden. Eine Diagnose des West-Nil-Virus erfolgt in erster Linie über einen indirekten Erregernachweis (ELISA). Antikörpernachweise müssen aufgrund von Kreuzreaktionen mit anderen Flaviviren über einen Virusneutralisationstest abgesichert werden. Differenzialdiagnostisch kommen hauptsächlich Krankheiten infrage, die neurologische Ausfallerscheinungen hervorrufen, unter anderem verschiedene virale und bakterielle Erkrankungen, jedoch auch Intoxikationen oder Traumata. Für die Prophylaxe einer West-Nil-Virusinfektion gibt es die Möglichkeiten der Anpassungen im Haltungsmanagement durch Mückenschutz- und Mückenbekämpfungsmaßnahmen sowie die der Impfung gegen das West-Nil-Virus. Die Impfung schützt jedoch nicht vor einer Infektion, sie mildert gegebenenfalls den Verlauf. Therapeutisch können nur die Symptome gelindert werden. Eine West-Nil- Virusinfektion bei Tieren sowie ein entsprechender Verdacht ist anzeigepflichtig und muss unverzüglich beim zuständigen Veterinäramt angezeigt werden. Experten scheinen sich einig, dass sich das West-Nil-Virus weiter in Deutschland verbreiten wird. Aufgrund des Klimawandels mit längeren Sommern und milderen Wintern finden Stechmücken zunehmend geeignetere Bedingungen, um das Virus weiterzugeben.
Autor*in:
Nathalie Christ
Gaswerkstraße 3
74336 Brackenheim
E-Mail: nathalie.christ@gmx.de
Entscheidender Beitrag zur Kontrolle von antibio-tikaresistenten Keimen sowie Zoonoseerregern in der Geflügelhaltung
Dr. Anika Friese, For-scherin am Institut für Tier- und Umwelthy-giene der Freien Universität Berlin, erhält in diesem Jahr den mit einer Urkunde und einem Preisgeld in Hö-he von 10.000 Euro versehenen Stockmeyer-Wissenschaftspreis für ihre Habilitationsschrift über zoonotische und antibiotikaresistente Bakterien bei Masthuhn und -pute.
Heinrich-Stockmeyer-Stiftung
Parkstraße 44–46
49214 Bad Rothenfelde
Telefon: 5424/299-144
E-Mail: info@heinrich-stockmeyer-stiftung.de
www.heinrich-stockmeyer-stiftung.de
Tierschutz auf dem Gnadenhof – Adressaten tierschutzrechtlicher Anordnungen
Beschluss des VG Koblenz vom 26. Februar 2024 (3 L 1074/23.KO)
Das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz hat entschieden, dass eine Anordnung der zuständigen Tierschutzbehörde gegenüber der Betreiberin eines sogenannten Gnadenhofs für Hunde, ihren Tierbestand wegen erheblicher tierschutzrechtlicher Verstöße auf maximal fünf Hunde zu reduzieren, rechtmäßig war. Die auf § 16a des Tierschutzgesetzes (TierSchG) gestützte Anordnung sei auch ermessensgerecht.
Autor*in:
Thorsten Bludau
Beigeordneter
Am Mittelfelde 169
30169 Hannover
Telefon: 0511 87953-21
E-Mail: bludau@nlt.de
Tierschutzrecht: Zuviel ist zuviel! – OVG Rheinland-Pfalz (Az.: 7 B 10232/24.OVG)
Das OVG Rheinland-Pfalz hat auch in zweiterInstand gegen die Betreiberin eine „Gnadenhofes“ entschieden, der das Veterinäramt die drastische Reduzierung ihres Tierbestandes aufgebe hatte.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Zum Verhältnis von Straf- und Verwaltungsverfahren – und: Zwei Verstöße reichen für ein Tierhaltungsverbot!
OVG des Saarlandes (Az.: 2 D 40/24 und 2 D 41/24)
Das OVG des Saarlandes (Az.: 2 D 40/24 und 2 D 41/24) hatte sich mit der Anordnung eines Tierhaltungs- und Betreuungsverbotes zu befassen, das mit der Anordnung einer Wegnahmeduldung sowie der Kostentragungspflicht für die Unterbringung des Tieres verbunden war. Zugleich gab es ein Strafverfahren gegen den früheren Tierhalter, das mit einer Einstellung nach § 153a StPO gegen Zahlung einer Geldauflage endete.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Entscheidung zur Rechtmäßigkeit einer Wegnahme – VG Bayreuth (Az.: B 1 K 21.1221)
Das VG Bayreuth (Az.: B 1 K 21.1221) hatte sich mit einem veterinäramtlichen Bescheid dahingehend zu befassen, dass der Klägerin der Verkauf bzw. die Abgabe ihrer Pferde aufgegeben sowie die Pferdehaltung untersagt wurde.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Neues vom Wolf: Der EuGH urteilt für den Artenschutz – der Streit um die Bayerische Wolfsverordnung geht weiter – Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht
Weniger die Interessen der Schafhalter als vielmehr die Interessen des Artenschutzes finden Berücksichtigung bei einigen aktuellen Entscheidungen.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Zur Kostenerstattung bei der tierschutzrechtlichen Wegnahme von Tieren – VG Neustadt / Weinstraße (Az.: 2 K 1013/21.NW)
Das VG Neustadt / Einstraße hatte sich mit der Frage zu befassen, in welcher Weise die Kosten, die eine Behörde aufgrund der Wegnahme von Tieren gegen deren früheren Halter geltend macht, erstattet werden können.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 0 61 74 / 25 78 83
Fax: 0 61 74 / 25 78 82
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
ANSCHRIFT
Bundesverband der beamteten Tierärzte e. V.
In der Au 1
96260 Weismain
Tel.: 0951/ 97458737
E-Mail: info@amtstierarzt.de
©2023 Bbt e.V. I Made with ♥ and ☕ by msisdesign.

ANSCHRIFT
Bundesverband der beamteten
Tierärzte e. V.
In der Au 1
96260 Weismain
Tel.: 0951/ 97458737
E-Mail: info@amtstierarzt.de

©2023 Bbt e.V. I Made with ♥ and ☕ by msisdesign.