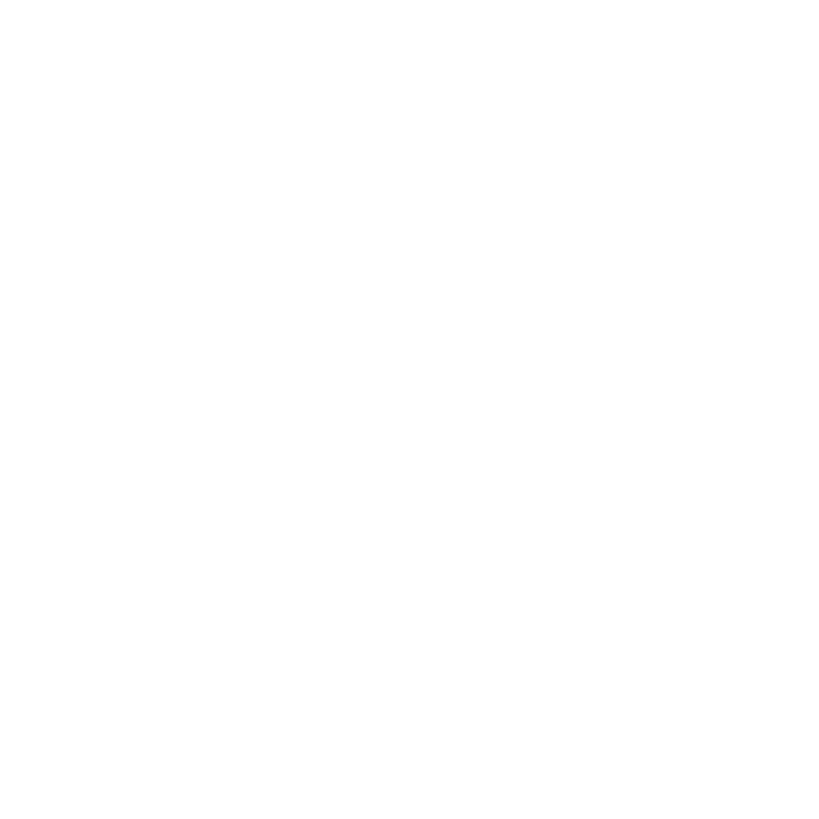Amtstierärztlicher Dienst
Ausgabe 4 / 2023
Amtstierärztlicher Dienst
Ausgabe 4 / 2023
„Social Media“ als Konfliktfeld für die staatliche Tierschutzüberwachung
Die Belange des Tierschutzes stehen im Fokus der Gesellschaft, dem hat der Gesetzgeber durch Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz besonders Rechnung getragen. Nach europäischem, Bundes- sowie Landesrecht obliegen die Überwachung und der Vollzug den jeweils zuständigen Landesbehörden (in der Regel den Veterinärbehörden).
Autor*in:
Laura Schuster
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüber-wachung und Landwirtschaft Sachgebiet Veterinärwesen
Dubinaweg 1
01968 Senftenberg
Telefon: 03573 870-4421
E-Mail: laura-schuster@osl-online.de
Das Problem der behördlichen Chargenvermutung
Keimreduzierung von Gewürzen beseitigt mikrobiologische Risiken
Der industrielle Gewürzeinkauf ist interna-tional. Zwischen den Rohstofferzeugern in den verschiedenen Ursprungsländern bestehen keine vergleichbaren Hygienestandards. Damit übernehmen die europäischen Verarbeiter eine große Verantwortung für die Sicherheit der in Verkehr gebrachten Produkte. Ein einziger Salmonellenfund kann enorme Auswirkungen für die beteiligten Firmen haben, weil die Behörden aufgrund der Chargenvermutung im Sinne der Lebensmittelbasisverordnung in der Regel einen Rückruf anordnen. Das ist in vielen Fällen übertrieben und praxisfern.
Autor*in:
Kräuter Mix GmbH
Abtswind
Dr. Fred Siewek
Tel.: 09383 204-366
E-Mail: fred.siewek@kraeuter-mix.de
www.kraeuter-mix.de
Illegaler Heimtierhandel und seine Auswirkungen auf deutsche Tierheime – Auswertung bekannt gewordener Fälle aus dem Jahr 2022
Der Deutsche Tierschutzbund wertet jährlich die Fälle von illegalem Heimhandel aus, die ihm bekannt werden. Die vergangenen Jahre waren dabei besonders durch die Coronapandemie geprägt. So führte der pandemiebedingte Haustierboom zu einem deutlichen Anstieg der Fall- und Tierzahlen sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021. 2021 waren die Zahlen illegal gehandelter Hunde und Katzen so hoch wie nie zuvor. Dies alles spiegeln auch die offiziellen Daten des Trade Control and Expert Systems (TRACES) wider. Im Jahr 2022 wurde ein geringfügiger Rückgang der Fall- und Tierzahlen il-legalen Handels ermittelt, was auf das Ende der Pandemie und seine Auswirkungen zurückzuführen ist. Die Anzahl illegal ge-handelter Tiere war dabei aber nahezu gleich mit 2020 und so-mit auf anhaltend hohem, besorgniserregendem Niveau. Eine weitere starke Belastung für die Tierheime resultierte (und re-sultiert) aus den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, etwa den erheblichen Kostensteigerungen für Energie und Futter. Im Jahr 2022 wurden 292 Fälle von illegalem Handel mit insgesamt mindestens 1.230 betroffenen Heimtieren und anderen Tierarten bekannt. In 253 Fällen (86,64 % der bekannt gewordenen Fälle) wurden ausschließlich Hunde gehandelt. In 26 Fällen (8,90 %) wurden nur Katzen und in sieben Fällen (2,39 %) Hunde und Katzen gemeinsam gehandelt. In einem Fall (0,34 %) wurden Hunde mit anderen Tierarten gemeinsam transportiert, in fünf Fällen (1,71 %) wurden nur andere Tierar-ten transportiert. In 222 Fällen (86,38 %) wurden Rassehunde gehandelt. Nahezu jedes dieser Tiere (99,19 %) wurde beschlagnahmt. Die nicht beschlagnahmten Tiere durften in das Bestimmungsland weitertransportiert werden, waren bereits verkauft und/oder bei den neuen Eigentümer*innen. Der Grund für eine Beschlagnahmung war fast immer ein Verstoß gegen das Tiergesundheitsgesetz (97,89 %). Die Tiere kamen vor allem aus Rumänien (59 Fälle), Bulgarien (49 Fälle), Polen und Ungarn (22 Fälle). Gut die Hälfte der Fälle – 149 (51,02 % aller Fälle) – wurden in Bayern aufgedeckt. In 218 Fällen (91,59 %) war Deutschland das Bestimmungsland, in 21 Fällen, bei denen das Ziel bekannt war – lediglich Transitland. In 213 Fällen (86,23 %) waren die Hunde und Katzen zu jung für einen legalen Grenzübertritt. In 146 Fällen (56,80 %) wurden durch die beschlagnahmenden Behörden oder Tierheime konkrete Angaben zum Gesundheitszustand der Tiere gemacht. In 121 Fällen waren die Tiere krank (82,87 %). Ein Großteil dieser Tiere litt an Durchfall (70,24 %, n=85), ausgelöst durch verschiedene Endoparasiten, wie z. B. Giardien oder durch das Parvovirus. In 17 Fällen (11,33 %) starben mindestens ein, meist sogar mehrere Tiere – insgesamt starben mindestens 28 Tiere während oder nach dem Transport. In 221 Fällen (96,08 %) waren Tierheime und Auffangstationen in die Unterbringung, Pflege und Versorgung beschlagnahmter Tiere involviert. Die Kosten für die Unterbringung und Pflege eines illegal gehandelten Hundes oder einer Katze beliefen sich auf durchschnittlich 19,21 Euro pro Tier und Tag (Die Spanne lag zwischen 10 und 33 Euro). Die Ergebnisse machen deutlich, dass der illegale Heimtierhandel auch nach der Pandemie ein großes Problem darstellt. Der Rückgang der ermittelten Zahlen ist auf eine gewisse Sättigung des Marktes u.a. infolge der deutlich gestiegenen legalen sowie illegalen Importe von Hunden und Katzen in den ersten beiden Jahren der Pandemie zurückzuführen. Nach wie vor ist von ei-ner sehr hohen Dunkelziffer auszugehen. Deutschlandweit geraten Tierschutzvereine und Tierheime an ihre personellen und finanziellen Grenzen. Kostensteigerungen, insbesondere für Energie, Futter und tierärztliche Behandlun-gen, haben die Arbeit der uns angeschlossenen Vereine im vergangenen Jahr enorm erschwert. Gerade vor diesem Hinter-grund stellt die Aufnahme illegal gehandelter Tiere eine zusätz-liche und vermeidbare Belastung dar, die aus Tierschutzsicht nicht weiter geduldet werden kann. Um die Problematik einzudämmen, müssten länderübergreifende Maßnahmen ergriffen werden – beispielsweise eine europaweite Verpflichtung zur Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen, eine gesetzliche Regulierung des Internethandels, verstärkte Aufklärung der Bevölkerung, Schulung der Polizei und des Zolls, vermehrte Kontrollen sowie härtere Strafen für Händler*innen. Tierheimen, die Tiere aufnehmen, werden entstehende Kosten oftmals nicht erstattet, weshalb gesetzlich bindende Regelun-gen zur Kostenübernahme durch die zuständigen Behörden ebenfalls dringend notwendig sind.
Autor*innen:
Romy Zeller, Verena Wirosaf, Moira Gerlach, Henriette Mackensen, Esther Müller
Dr. Romy Zeller
Fachreferentin für Heimtiere Deutscher Tierschutzbund e.V.
Akademie für Tierschutz
Spechtstraße 1
85579 Neubiberg
Telefon: 089 600291 43
Romy.Zeller@tierschutzakademie.de
Prüfpunkte nach Art. 21 (2) OCR zu den Tierschutzauflagen beim Transport von Tieren Vorstellung einer Checkliste für Rinderexporte
Die Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen regelt u.a. die Prüfverpflichtung für Langstreckentransporte gem. Verordnung (EG) 1/2005. Die Überprüfung dient der Einhaltung der Tierschutzauflagen beim Transport von Haus-Equiden, -Rindern, -Schafen, -Ziegen oder -Schweinen und umfasst zahlreiche Kriterien aus verschiedenen Rechtsbereichen. Die vorliegende Arbeit stellt das Ausmaß der Prüfverpflichtung dar und eine umfangreiche Checkliste vor.
Autor*innen:
Dr. med. vet. Alexander Rabitsch
Tierärztliche Praxis Rosental
Waldstraße 13
A-9170 Ferlach
E-Mail: animalwelfare@rabitsch-vet.at
Dr. med. vet. Peter Scheibl
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Veterinärstraße 2
85764 Oberschleißheim
E-Mail: Peter.Scheibl@lgl.bayern.de
Fallbericht und tierschutzrechtliche Beurteilung einer Wolfshybridenhaltung in einem Privathaushalt
Die Haltung und Zucht von Wolfshybriden und Wolfshunden übt auf viele Menschen eine große Faszination aus und ist in Deutschland keine Seltenheit mehr. Allerdings stellt die Haltung dieser Tiere an die Tierhalter erhebliche Ansprüche, damit die Tiere tierschutz- und verhaltensgerecht gehalten werden können. Das behördliche Vorgehen sowie die Schwierigkeiten bei der Beurteilung und die Fortnahme werden als Fallbericht beschrieben.
Autor*in:
Katja Gritschke
Amtstierärztin
Vogelsbergstraße 32
36341 Lauterbach
Tierschutz-Monitoringsysteme für Schlachtbetriebe
Immer wiederkehrende Tierschutzverstöße in Schlachtbetrieben verdeutlichen, dass das derzeit angewandte Kontrollsystem nicht in ausreichendem Maße funktioniert. Handschriftliche Aufzeichnungen und sporadische Stichprobenkontrollen erweisen sich als unzureichend, um sämtliche Vorfälle, die sich teilweise in Minuten- oder Sekundenschnelle abspielen, zu erkennen und zu korrigieren. Dadurch laufen Schlachtbetriebe, Fleischverarbeiter, Tierärzte*innen und Behörden täglich erneut Gefahr, ihre Reputation und Wertschätzung in der Gesellschaft und bei den Endkonsumenten weiter zu verlieren. Unsere intelligenten Sensor- und Kamerasysteme schließen diese bestehende Lücke durch völlige Transparenz, durchgehende Echtzeitanalyse mit proaktiver Benachrichtigung, durch eine fundierte Datenbasis und, in Kombination mit unserer digitalen Checklisten-App, durch einen effizient gesteuerten Prozess im gesamten Lebendtierbereich von Schlachtbetrieben.
Autor*in:
Dipl.-Ing. (FH) Markus Fischer
Geschäftsleitung bei Genba Solutions GmbH
Vogelweidgasse 2
A-3435 Zwentendorf an der Donau
E-Mail: markus.fischer@genbasolutions.com
Umfassende Ausbruchsaufklärung eines Milzbrandfalles von 2021 in Oberbayern
Milzbrand (Anthrax) ist eine Zoonose, die durch das Endosporen bildende Bakterium Bacillus anthracis verursacht wird. Milzbrand ist in Deutschland sehr selten. In Bayern trat der letzte Fall im Juli 2009 bei Kühen auf. Nach einer langen Ruhephase brach die Krankheit im August 2021 erneut aus und führte zum Tod einer trächtigen Kuh. Bemerkenswerterweise betrafen beide Ausbrüche dieselbe Weide, was auf einen direkten epidemiologischen Zusammenhang schließen lässt. B. anthracis konnte aus Blutkulturen angezüchtet und durch PCR bestätigt werden. Außerdem ermöglichten kürzlich entwickelte diagnostische Teste, die auf Rezeptor-Bindeproteinen aus Bakteriophagen basieren, den schnellen Nachweis von B. anthracis-Zellen direkt in klinischen Proben. Das Genom des isolierten B. anthracis-Stammes mit der Bezeichnung BF-5 wurde einer DNA-Sequenzierung unterzogen und phylogenetisch in eine für europäische B. anthracis-Stämme typische Verwandtschafts-Gruppe (B.Br.CNEVA) eingeordnet. Das BF-5 Genom war nahezu identisch mit dem des Isolats BF-1 aus dem Jahr 2009. Außerdem wurde B. anthracis in Bodenproben an Stellen nachgewiesen, an denen die Kuh auf der Weide verstorben war. Auch für diese Bodenproben lieferten die neuentwickelten diagnostischen Teste den mikroskopischen Nachweis und ermöglichten sogar die direkte Isolierung von B. anthracis.
Autor*innen:
Peter Braun, Markus Antwerpen, Gregor Grass
Oberstleutnant d. R. Dr. Peter Braun
Fraunhofer-Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie ITMP Immunologie, Infektions- und Pandemieforschung
Türkenstraße 87
80799 München
E-Mail: peter.braun@itmp.fraunhofer.de
ASP: Neue Leitlinien zur Auslauf- und Freilandhaltung von Hausschweinen
Expertengruppe präzisiert Bedingungen zur Haltung von Hausschweinen in ASP-Sperrzonen in Auslauf- und Freilandhaltungen
Seit der erstmaligen Feststellung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland im September 2020 traten bei Wildschweinen bisher mehr als 5.500 Fälle in Teilen von Brandenburg (BB), Mecklenburg-Vorpommern (MV) und Sachsen auf. Zudem gab es bisher acht Ausbrüche in Hausschweinehaltungen in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Der wirtschaftliche Schaden für Schweinehalter, sofern sie von ASP-Sperrzonen betroffen sind, ist immens, und Marktverwerfungen durch ASP-bedingte Exportbeschränkungen sind bis heute bundesweit spürbar. Die Empfehlungen der Europäischen Union (EU) sahen in der Vergangenheit ein generelles Verbot der Freilandhaltung und das Untersagen von Auslaufhaltungen in ASP-Sperrzonen vor. Dies wurde allerdings 2022/2023 mit dem Ziel überarbeitet, die Auslauf- und Freilandhaltung unter bestimmten Bedingungen in diesen Gebieten zu ermöglichen. Die Leitlinien zur Auslauf- und Freilandhaltung von Hausschweinen präzisieren nun in Deutschland, unter welchen Bedingungen diese Haltungsarten in Sperrzonen weiterhin möglich sind.
Autor*in:
Dr. Wiebke Scheer
Warmbüchenstraße 3
30159 Hannover
E-Mail: wiebke.scheer@landvolk.org
Risiken beim Zukauf von Zuchtrindern: Ein Fallbericht
Im Februar 2022 wurde in einem Mutter-kuhbetrieb in Sachsen-Anhalt der Verdacht auf Ausbruch einer Bovinen Herpesvirus-Typ 1 (BoHV-1) Infektion ausgesprochen. Betroffen waren drei Bullen, die aus einem nicht BoHV-1-freien Betrieb in Irland kamen. Quarantäne- und betriebseigene Bio-sicherheitsmaßnahmen sowie umfassende serologische Unter-suchungen auf BoHV-1 Antikörper verhinderten weitestgehend die Ausbreitung des Virus im Bestand und in andere Rinderhal-tungen. Lediglich eine Kuh des Bestandes reagierte zunächst positiv im gB-ELISA und anschließend auch im gE-ELISA. Als Übertragungsweg konnten weder direkte noch indirekte Kontakte nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden. Schlussfolgernd sollten Rinder grundsätzlich nur von Betrieben bzw. aus Regionen bezogen werden, die einen zur eigenen Re-gion vergleichbaren Tierseuchenstatus, insbesondere hinsicht-lich BoHV1, BVDV, Leukose und Brucellose, besitzen. Zusätz-lich sollten zugekaufte Tiere vor Eingliederung in den Betrieb stets in einer wirksamen Quarantäne gehalten werden. Zudem wird neben der klinischen Untersuchung auch eine labordiagnostische Bestätigung der Freiheit von Tierseuchen dringend empfohlen.
Autor*innen:
A. Stagnoli, M. Linder, R. V. House, K. Albrecht, A. Kroll, W. Gaede
Alice Stagnoli
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt Fachbereich Veterinärmedizin
Haferbreiter Weg 132 – 135
39576 Stendal
E-Mail: alice.stagnoli@sachsen-anhalt.de
Impfung verbessert Tier- und Umweltschutz in der Fleischproduktion
Die meisten für die Mast bestimmten männlichen Ferkel werden chirurgisch kastriert. Ohne diesen Eingriff kann das Fleisch einen unangenehmen Geruch entwickeln und ist dann kaum verkäuflich. Eine mögliche Alternative ist die Immunkastration. Dabei wird den Tieren ein Impfstoff verabreicht, der die Bildung von Geschlechtshormonen zeitweise unterdrückt.
Autor*in:
Prof. Dr. Daniel Mörlein
Georg-August-Universität Göttingen
Department für Nutztierwissenschaften Abteilung Produktqualität tierischer Erzeugnisse
Kellnerweg 6
37077 Göttingen
Telefon: 0551 39-25601
E-Mail: daniel.moerlein@uni-goettingen.de
Internet: http://www.uni-goettingen.de/de/91413.html
Die Nutzung bestandsspezifischer (autogener) Impfstoffe nach dem Inkrafttreten der europäischen Tierarzneimittel-Verordnung 2019/6
Die Verordnung (EU) 2019/6 über Tierarzneimittel enthält erstmals einheitliche Regelungen für die bestandsspezifischen/ autogenen Tierimpfstoffe. Sie sind als inaktivierte immunologische Tierarzneimittel definiert, die in der epidemiologischen Einheit angewendet werden dürfen, aus denen die zu ihrer Herstellung verwendeten Isolate stammen. Eine Anwendung ist außerdem in einer anderen epidemiologischen Einheit zulässig, zu der gesicherte epidemiologische Ver-bindungen bestehen. Ein Einsatz ist nur erlaubt, wenn für die betreffende Zieltierart und das Anwendungsgebiet kein Tierimpfstoff zugelassen ist. Die Herstellung der autogenen Impfstoffe muss unter für diese Produkte definierten GMP-Bedingungen erfolgen, die durch spezielle Rechtsakte noch definiert werden müssen. Für die autogenen Impfstoffe gelten nur die im Artikel 2 Absatz 3 genannten Artikel der EU-Tierarzneimittel-Verordnung. Mit diesen Regelungen wurden in der EU sowohl Rechtssicherheit bezüglich der bestandsspezifischen Tierimpfstoffe als auch die Voraussetzungen für eine hohe Produktsicherheit geschaffen.
Autor*innen:
Prof. Dr. med. vet. habil. Hans-Joachim Selbitz
Gänseblümchenweg 2
04158 Leipzig
E-Mail: arbeitskreis.tiergarten@hjselbitz.de
Dr. med. vet. Ilka Emmerich
VETIDATA, Institut für Pharmakologie, Pharmazie und Toxikologie, Veterinärmedizinische Fakultät Universität Leipzig
An den Tierkliniken 39
04103 Leipzig
E-Mail: emmerich@vetmed.uni-leipzig.de
Tierarztvorbehalt für die Anwendung nicht verschreibungspflichtiger Humanhomöopathika bei Tieren
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat sich mit Beschluss vom 29. September 20222 mit einem Tierarztvorbehalt für die Anwendung nicht verschreibungspflichtiger Humanhomöopathika bei Tieren befasst.
Autor*in:
Thorsten Bludau
Beigeordneter
Am Mittelfelde 169
30169 Hannover
Telefon: 0511 87953-21
E-Mail: bludau@nlt.de
Behördlich angeordnete Unfruchtbarmachung von Qualzuchten – OVG Thüringen (Az.: 3 EO 508/21)
Das Veterinäramt hatte bereits 2019 unter Anordnung der sofortigen Vollziehung ein Zuchtverbot für Tiere verhängt, die als Qualzuchten einzustufen waren (hier ging es um Nackthunde); gleichzeitig ordnete sie die Unfruchtbarmachung der Hunde des Bestandes der Klägerin an.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kornberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 06174 257883
Fax: 06174 257882
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Ingelvac® Ery – Innovatives Impfkonzept mit neuem Rotlauf-Impfstoff von Boehringer Ingelheim
Nach Jahrzehnten, in denen Erysipelothrix-Infektionen nur eine minimale Bedeutung in der Schweinehaltung hatten, scheint Rotlauf wieder auf dem Vormarsch zu sein, da sich die Umweltbedingungen und Tierhaltungsvorschriften ändern und damit der Einsatz von organischem Beschäftigungsmaterial, biologische und Außenklimahaltungsformen zunehmen und der Einsatz von Antibiotika reduziert wird. Auch in modernen Produktionssystemen ist es nicht gelungen, die Erkrankung oder den Erreger vollständig zu eliminieren.
Quelle:
https://www.vetmedica.de/produkte-tierarzt/Schwein/ingelvac-ery/7969
Dr. Kevin Kress
Telefon: 06132 77-181179
E-Mail: kevin_benjamin.kress@boehringer-ingelheim.com
„Social Media“ als Konfliktfeld für die staatliche Tierschutzüberwachung
Die Belange des Tierschutzes stehen im Fokus der Gesellschaft, dem hat der Gesetzgeber durch Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz besonders Rechnung getragen. Nach europäischem, Bundes- sowie Landesrecht obliegen die Überwachung und der Vollzug den jeweils zuständigen Landesbehörden (in der Regel den Veterinärbehörden).
Autor*in:
Laura Schuster
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüber-wachung und Landwirtschaft Sachgebiet Veterinärwesen
Dubinaweg 1
01968 Senftenberg
Telefon: 03573 870-4421
E-Mail: laura-schuster@osl-online.de
Das Problem der behördlichen Chargenvermutung
Keimreduzierung von Gewürzen beseitigt mikrobiologische Risiken
Der industrielle Gewürzeinkauf ist interna-tional. Zwischen den Rohstofferzeugern in den verschiedenen Ursprungsländern bestehen keine vergleichbaren Hygienestandards. Damit übernehmen die europäischen Verarbeiter eine große Verantwortung für die Sicherheit der in Verkehr gebrachten Produkte. Ein einziger Salmonellenfund kann enorme Auswirkungen für die beteiligten Firmen haben, weil die Behörden aufgrund der Chargenvermutung im Sinne der Lebensmittelbasisverordnung in der Regel einen Rückruf anordnen. Das ist in vielen Fällen übertrieben und praxisfern.
Autor*in:
Kräuter Mix GmbH
Abtswind
Dr. Fred Siewek
Tel.: 09383 204-366
E-Mail: fred.siewek@kraeuter-mix.de
www.kraeuter-mix.de
Illegaler Heimtierhandel und seine Auswirkungen auf deutsche Tierheime – Auswertung bekannt gewordener Fälle aus dem Jahr 2022
Der Deutsche Tierschutzbund wertet jährlich die Fälle von illegalem Heimhandel aus, die ihm bekannt werden. Die vergangenen Jahre waren dabei besonders durch die Coronapandemie geprägt. So führte der pandemiebedingte Haustierboom zu einem deutlichen Anstieg der Fall- und Tierzahlen sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021. 2021 waren die Zahlen illegal gehandelter Hunde und Katzen so hoch wie nie zuvor. Dies alles spiegeln auch die offiziellen Daten des Trade Control and Expert Systems (TRACES) wider. Im Jahr 2022 wurde ein geringfügiger Rückgang der Fall- und Tierzahlen il-legalen Handels ermittelt, was auf das Ende der Pandemie und seine Auswirkungen zurückzuführen ist. Die Anzahl illegal ge-handelter Tiere war dabei aber nahezu gleich mit 2020 und so-mit auf anhaltend hohem, besorgniserregendem Niveau. Eine weitere starke Belastung für die Tierheime resultierte (und re-sultiert) aus den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, etwa den erheblichen Kostensteigerungen für Energie und Futter. Im Jahr 2022 wurden 292 Fälle von illegalem Handel mit insgesamt mindestens 1.230 betroffenen Heimtieren und anderen Tierarten bekannt. In 253 Fällen (86,64 % der bekannt gewordenen Fälle) wurden ausschließlich Hunde gehandelt. In 26 Fällen (8,90 %) wurden nur Katzen und in sieben Fällen (2,39 %) Hunde und Katzen gemeinsam gehandelt. In einem Fall (0,34 %) wurden Hunde mit anderen Tierarten gemeinsam transportiert, in fünf Fällen (1,71 %) wurden nur andere Tierar-ten transportiert. In 222 Fällen (86,38 %) wurden Rassehunde gehandelt. Nahezu jedes dieser Tiere (99,19 %) wurde beschlagnahmt. Die nicht beschlagnahmten Tiere durften in das Bestimmungsland weitertransportiert werden, waren bereits verkauft und/oder bei den neuen Eigentümer*innen. Der Grund für eine Beschlagnahmung war fast immer ein Verstoß gegen das Tiergesundheitsgesetz (97,89 %). Die Tiere kamen vor allem aus Rumänien (59 Fälle), Bulgarien (49 Fälle), Polen und Ungarn (22 Fälle). Gut die Hälfte der Fälle – 149 (51,02 % aller Fälle) – wurden in Bayern aufgedeckt. In 218 Fällen (91,59 %) war Deutschland das Bestimmungsland, in 21 Fällen, bei denen das Ziel bekannt war – lediglich Transitland. In 213 Fällen (86,23 %) waren die Hunde und Katzen zu jung für einen legalen Grenzübertritt. In 146 Fällen (56,80 %) wurden durch die beschlagnahmenden Behörden oder Tierheime konkrete Angaben zum Gesundheitszustand der Tiere gemacht. In 121 Fällen waren die Tiere krank (82,87 %). Ein Großteil dieser Tiere litt an Durchfall (70,24 %, n=85), ausgelöst durch verschiedene Endoparasiten, wie z. B. Giardien oder durch das Parvovirus. In 17 Fällen (11,33 %) starben mindestens ein, meist sogar mehrere Tiere – insgesamt starben mindestens 28 Tiere während oder nach dem Transport. In 221 Fällen (96,08 %) waren Tierheime und Auffangstationen in die Unterbringung, Pflege und Versorgung beschlagnahmter Tiere involviert. Die Kosten für die Unterbringung und Pflege eines illegal gehandelten Hundes oder einer Katze beliefen sich auf durchschnittlich 19,21 Euro pro Tier und Tag (Die Spanne lag zwischen 10 und 33 Euro). Die Ergebnisse machen deutlich, dass der illegale Heimtierhandel auch nach der Pandemie ein großes Problem darstellt. Der Rückgang der ermittelten Zahlen ist auf eine gewisse Sättigung des Marktes u.a. infolge der deutlich gestiegenen legalen sowie illegalen Importe von Hunden und Katzen in den ersten beiden Jahren der Pandemie zurückzuführen. Nach wie vor ist von ei-ner sehr hohen Dunkelziffer auszugehen. Deutschlandweit geraten Tierschutzvereine und Tierheime an ihre personellen und finanziellen Grenzen. Kostensteigerungen, insbesondere für Energie, Futter und tierärztliche Behandlun-gen, haben die Arbeit der uns angeschlossenen Vereine im vergangenen Jahr enorm erschwert. Gerade vor diesem Hinter-grund stellt die Aufnahme illegal gehandelter Tiere eine zusätz-liche und vermeidbare Belastung dar, die aus Tierschutzsicht nicht weiter geduldet werden kann. Um die Problematik einzudämmen, müssten länderübergreifende Maßnahmen ergriffen werden – beispielsweise eine europaweite Verpflichtung zur Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen, eine gesetzliche Regulierung des Internethandels, verstärkte Aufklärung der Bevölkerung, Schulung der Polizei und des Zolls, vermehrte Kontrollen sowie härtere Strafen für Händler*innen. Tierheimen, die Tiere aufnehmen, werden entstehende Kosten oftmals nicht erstattet, weshalb gesetzlich bindende Regelun-gen zur Kostenübernahme durch die zuständigen Behörden ebenfalls dringend notwendig sind.
Autor*innen:
Romy Zeller, Verena Wirosaf, Moira Gerlach, Henriette Mackensen, Esther Müller
Dr. Romy Zeller
Fachreferentin für Heimtiere Deutscher Tierschutzbund e.V.
Akademie für Tierschutz
Spechtstraße 1
85579 Neubiberg
Telefon: 089 600291 43
Romy.Zeller@tierschutzakademie.de
Prüfpunkte nach Art. 21 (2) OCR zu den Tierschutzauflagen beim Transport von Tieren Vorstellung einer Checkliste für Rinderexporte
Die Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen regelt u.a. die Prüfverpflichtung für Langstreckentransporte gem. Verordnung (EG) 1/2005. Die Überprüfung dient der Einhaltung der Tierschutzauflagen beim Transport von Haus-Equiden, -Rindern, -Schafen, -Ziegen oder -Schweinen und umfasst zahlreiche Kriterien aus verschiedenen Rechtsbereichen. Die vorliegende Arbeit stellt das Ausmaß der Prüfverpflichtung dar und eine umfangreiche Checkliste vor.
Autor*innen:
Dr. med. vet. Alexander Rabitsch
Tierärztliche Praxis Rosental
Waldstraße 13
A-9170 Ferlach
E-Mail: animalwelfare@rabitsch-vet.at
Dr. med. vet. Peter Scheibl
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Veterinärstraße 2
85764 Oberschleißheim
E-Mail: Peter.Scheibl@lgl.bayern.de
Fallbericht und tierschutzrechtliche Beurteilung einer Wolfshybridenhaltung in einem Privathaushalt
Die Haltung und Zucht von Wolfshybriden und Wolfshunden übt auf viele Menschen eine große Faszination aus und ist in Deutschland keine Seltenheit mehr. Allerdings stellt die Haltung dieser Tiere an die Tierhalter erhebliche Ansprüche, damit die Tiere tierschutz- und verhaltensgerecht gehalten werden können. Das behördliche Vorgehen sowie die Schwierigkeiten bei der Beurteilung und die Fortnahme werden als Fallbericht beschrieben.
Autor*in:
Katja Gritschke
Amtstierärztin
Vogelsbergstraße 32
36341 Lauterbach
Tierschutz-Monitoringsysteme für Schlachtbetriebe
Immer wiederkehrende Tierschutzverstöße in Schlachtbetrieben verdeutlichen, dass das derzeit angewandte Kontrollsystem nicht in ausreichendem Maße funktioniert. Handschriftliche Aufzeichnungen und sporadische Stichprobenkontrollen erweisen sich als unzureichend, um sämtliche Vorfälle, die sich teilweise in Minuten- oder Sekundenschnelle abspielen, zu erkennen und zu korrigieren. Dadurch laufen Schlachtbetriebe, Fleischverarbeiter, Tierärzte*innen und Behörden täglich erneut Gefahr, ihre Reputation und Wertschätzung in der Gesellschaft und bei den Endkonsumenten weiter zu verlieren. Unsere intelligenten Sensor- und Kamerasysteme schließen diese bestehende Lücke durch völlige Transparenz, durchgehende Echtzeitanalyse mit proaktiver Benachrichtigung, durch eine fundierte Datenbasis und, in Kombination mit unserer digitalen Checklisten-App, durch einen effizient gesteuerten Prozess im gesamten Lebendtierbereich von Schlachtbetrieben.
Autor*in:
Dipl.-Ing. (FH) Markus Fischer
Geschäftsleitung bei Genba Solutions GmbH
Vogelweidgasse 2
A-3435 Zwentendorf an der Donau
E-Mail: markus.fischer@genbasolutions.com
Umfassende Ausbruchsaufklärung eines Milzbrandfalles von 2021 in Oberbayern
Milzbrand (Anthrax) ist eine Zoonose, die durch das Endosporen bildende Bakterium Bacillus anthracis verursacht wird. Milzbrand ist in Deutschland sehr selten. In Bayern trat der letzte Fall im Juli 2009 bei Kühen auf. Nach einer langen Ruhephase brach die Krankheit im August 2021 erneut aus und führte zum Tod einer trächtigen Kuh. Bemerkenswerterweise betrafen beide Ausbrüche dieselbe Weide, was auf einen direkten epidemiologischen Zusammenhang schließen lässt. B. anthracis konnte aus Blutkulturen angezüchtet und durch PCR bestätigt werden. Außerdem ermöglichten kürzlich entwickelte diagnostische Teste, die auf Rezeptor-Bindeproteinen aus Bakteriophagen basieren, den schnellen Nachweis von B. anthracis-Zellen direkt in klinischen Proben. Das Genom des isolierten B. anthracis-Stammes mit der Bezeichnung BF-5 wurde einer DNA-Sequenzierung unterzogen und phylogenetisch in eine für europäische B. anthracis-Stämme typische Verwandtschafts-Gruppe (B.Br.CNEVA) eingeordnet. Das BF-5 Genom war nahezu identisch mit dem des Isolats BF-1 aus dem Jahr 2009. Außerdem wurde B. anthracis in Bodenproben an Stellen nachgewiesen, an denen die Kuh auf der Weide verstorben war. Auch für diese Bodenproben lieferten die neuentwickelten diagnostischen Teste den mikroskopischen Nachweis und ermöglichten sogar die direkte Isolierung von B. anthracis.
Autor*innen:
Peter Braun, Markus Antwerpen, Gregor Grass
Oberstleutnant d. R. Dr. Peter Braun
Fraunhofer-Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie ITMP Immunologie, Infektions- und Pandemieforschung
Türkenstraße 87
80799 München
E-Mail: peter.braun@itmp.fraunhofer.de
ASP: Neue Leitlinien zur Auslauf- und Freilandhaltung von Hausschweinen
Expertengruppe präzisiert Bedingungen zur Haltung von Hausschweinen in ASP-Sperrzonen in Auslauf- und Freilandhaltungen
Seit der erstmaligen Feststellung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland im September 2020 traten bei Wildschweinen bisher mehr als 5.500 Fälle in Teilen von Brandenburg (BB), Mecklenburg-Vorpommern (MV) und Sachsen auf. Zudem gab es bisher acht Ausbrüche in Hausschweinehaltungen in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Der wirtschaftliche Schaden für Schweinehalter, sofern sie von ASP-Sperrzonen betroffen sind, ist immens, und Marktverwerfungen durch ASP-bedingte Exportbeschränkungen sind bis heute bundesweit spürbar. Die Empfehlungen der Europäischen Union (EU) sahen in der Vergangenheit ein generelles Verbot der Freilandhaltung und das Untersagen von Auslaufhaltungen in ASP-Sperrzonen vor. Dies wurde allerdings 2022/2023 mit dem Ziel überarbeitet, die Auslauf- und Freilandhaltung unter bestimmten Bedingungen in diesen Gebieten zu ermöglichen. Die Leitlinien zur Auslauf- und Freilandhaltung von Hausschweinen präzisieren nun in Deutschland, unter welchen Bedingungen diese Haltungsarten in Sperrzonen weiterhin möglich sind.
Autor*in:
Dr. Wiebke Scheer
Warmbüchenstraße 3
30159 Hannover
E-Mail: wiebke.scheer@landvolk.org
Risiken beim Zukauf von Zuchtrindern: Ein Fallbericht
Im Februar 2022 wurde in einem Mutter-kuhbetrieb in Sachsen-Anhalt der Verdacht auf Ausbruch einer Bovinen Herpesvirus-Typ 1 (BoHV-1) Infektion ausgesprochen. Betroffen waren drei Bullen, die aus einem nicht BoHV-1-freien Betrieb in Irland kamen. Quarantäne- und betriebseigene Bio-sicherheitsmaßnahmen sowie umfassende serologische Unter-suchungen auf BoHV-1 Antikörper verhinderten weitestgehend die Ausbreitung des Virus im Bestand und in andere Rinderhal-tungen. Lediglich eine Kuh des Bestandes reagierte zunächst positiv im gB-ELISA und anschließend auch im gE-ELISA. Als Übertragungsweg konnten weder direkte noch indirekte Kontakte nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden. Schlussfolgernd sollten Rinder grundsätzlich nur von Betrieben bzw. aus Regionen bezogen werden, die einen zur eigenen Re-gion vergleichbaren Tierseuchenstatus, insbesondere hinsicht-lich BoHV1, BVDV, Leukose und Brucellose, besitzen. Zusätz-lich sollten zugekaufte Tiere vor Eingliederung in den Betrieb stets in einer wirksamen Quarantäne gehalten werden. Zudem wird neben der klinischen Untersuchung auch eine labordiagnostische Bestätigung der Freiheit von Tierseuchen dringend empfohlen.
Autor*innen:
A. Stagnoli, M. Linder, R. V. House, K. Albrecht, A. Kroll, W. Gaede
Alice Stagnoli
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt Fachbereich Veterinärmedizin
Haferbreiter Weg 132 – 135
39576 Stendal
E-Mail: alice.stagnoli@sachsen-anhalt.de
Impfung verbessert Tier- und Umweltschutz in der Fleischproduktion
Die meisten für die Mast bestimmten männlichen Ferkel werden chirurgisch kastriert. Ohne diesen Eingriff kann das Fleisch einen unangenehmen Geruch entwickeln und ist dann kaum verkäuflich. Eine mögliche Alternative ist die Immunkastration. Dabei wird den Tieren ein Impfstoff verabreicht, der die Bildung von Geschlechtshormonen zeitweise unterdrückt.
Autor*in:
Prof. Dr. Daniel Mörlein
Georg-August-Universität Göttingen
Department für Nutztierwissenschaften Abteilung Produktqualität tierischer Erzeugnisse
Kellnerweg 6
37077 Göttingen
Telefon: 0551 39-25601
E-Mail: daniel.moerlein@uni-goettingen.de
Internet: http://www.uni-goettingen.de/de/91413.html
Die Nutzung bestandsspezifischer (autogener) Impfstoffe nach dem Inkrafttreten der europäischen Tierarzneimittel-Verordnung 2019/6
Die Verordnung (EU) 2019/6 über Tierarzneimittel enthält erstmals einheitliche Regelungen für die bestandsspezifischen/ autogenen Tierimpfstoffe. Sie sind als inaktivierte immunologische Tierarzneimittel definiert, die in der epidemiologischen Einheit angewendet werden dürfen, aus denen die zu ihrer Herstellung verwendeten Isolate stammen. Eine Anwendung ist außerdem in einer anderen epidemiologischen Einheit zulässig, zu der gesicherte epidemiologische Ver-bindungen bestehen. Ein Einsatz ist nur erlaubt, wenn für die betreffende Zieltierart und das Anwendungsgebiet kein Tierimpfstoff zugelassen ist. Die Herstellung der autogenen Impfstoffe muss unter für diese Produkte definierten GMP-Bedingungen erfolgen, die durch spezielle Rechtsakte noch definiert werden müssen. Für die autogenen Impfstoffe gelten nur die im Artikel 2 Absatz 3 genannten Artikel der EU-Tierarzneimittel-Verordnung. Mit diesen Regelungen wurden in der EU sowohl Rechtssicherheit bezüglich der bestandsspezifischen Tierimpfstoffe als auch die Voraussetzungen für eine hohe Produktsicherheit geschaffen.
Autor*innen:
Prof. Dr. med. vet. habil. Hans-Joachim Selbitz
Gänseblümchenweg 2
04158 Leipzig
E-Mail: arbeitskreis.tiergarten@hjselbitz.de
Dr. med. vet. Ilka Emmerich
VETIDATA, Institut für Pharmakologie, Pharmazie und Toxikologie, Veterinärmedizinische Fakultät Universität Leipzig
An den Tierkliniken 39
04103 Leipzig
E-Mail: emmerich@vetmed.uni-leipzig.de
Tierarztvorbehalt für die Anwendung nicht verschreibungspflichtiger Humanhomöopathika bei Tieren
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat sich mit Beschluss vom 29. September 20222 mit einem Tierarztvorbehalt für die Anwendung nicht verschreibungspflichtiger Humanhomöopathika bei Tieren befasst.
Autor*in:
Thorsten Bludau
Beigeordneter
Am Mittelfelde 169
30169 Hannover
Telefon: 0511 87953-21
E-Mail: bludau@nlt.de
Behördlich angeordnete Unfruchtbarmachung von Qualzuchten – OVG Thüringen (Az.: 3 EO 508/21)
Das Veterinäramt hatte bereits 2019 unter Anordnung der sofortigen Vollziehung ein Zuchtverbot für Tiere verhängt, die als Qualzuchten einzustufen waren (hier ging es um Nackthunde); gleichzeitig ordnete sie die Unfruchtbarmachung der Hunde des Bestandes der Klägerin an.
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kornberger Straße 9
61462 Königstein
Telefon: 06174 257883
Fax: 06174 257882
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
Ingelvac® Ery – Innovatives Impfkonzept mit neuem Rotlauf-Impfstoff von Boehringer Ingelheim
Nach Jahrzehnten, in denen Erysipelothrix-Infektionen nur eine minimale Bedeutung in der Schweinehaltung hatten, scheint Rotlauf wieder auf dem Vormarsch zu sein, da sich die Umweltbedingungen und Tierhaltungsvorschriften ändern und damit der Einsatz von organischem Beschäftigungsmaterial, biologische und Außenklimahaltungsformen zunehmen und der Einsatz von Antibiotika reduziert wird. Auch in modernen Produktionssystemen ist es nicht gelungen, die Erkrankung oder den Erreger vollständig zu eliminieren.
Quelle:
https://www.vetmedica.de/produkte-tierarzt/Schwein/ingelvac-ery/7969
Dr. Kevin Kress
Telefon: 06132 77-181179
E-Mail: kevin_benjamin.kress@boehringer-ingelheim.com
ANSCHRIFT
Bundesverband der beamteten Tierärzte e. V.
In der Au 1
96260 Weismain
Tel.: 0951/ 97458737
E-Mail: info@amtstierarzt.de
©2023 Bbt e.V. I Made with ♥ and ☕ by msisdesign.

ANSCHRIFT
Bundesverband der beamteten
Tierärzte e. V.
In der Au 1
96260 Weismain
Tel.: 0951/ 97458737
E-Mail: info@amtstierarzt.de

©2023 Bbt e.V. I Made with ♥ and ☕ by msisdesign.