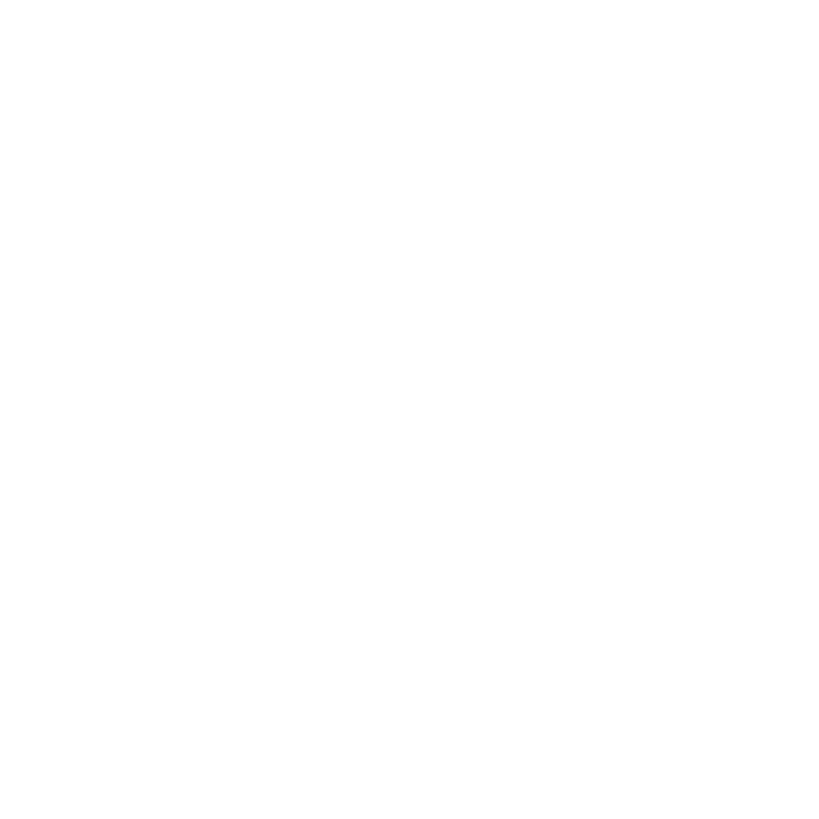Amtstierärztlicher Dienst
Ausgabe 2/2024
Amtstierärztlicher Dienst
Ausgabe 2/2024
U40-Seminar 2024 des BbT – Startschuss für Weiterbildung junger amtlicher Tierärzt*innen
Nach drei sehr gelungenen Veranstaltungen in der Reihe der U40 Seminare des BbT in Fulda und Kassel findet das nächste Seminar nun am 15/16.11.2024 in der Lutherstadt Wittenberg statt.
Autor*innen:
Katharina Wadepohl, Maximiliane Puchert
Bericht über ein BTSF-Training und Aktuelles zu Lebensmittelsicherheits- und Risikobewertungen
Der Bericht fasst wesentliche Schwerpunk-te der BTSF-Schulungsreihe Lebensmittelhygiene in der Primär-produktion und des Erfahrungsaustausches im Februar 2024 in Venedig zusammen. Daneben wird auf Aktuelles im Bereich der Lebensmittelsicherheits- und Risikobewertungen2 einge-gangen. Das Kernthema der Trainings sind die Hygieneanforde-rungen an die Primärproduktion bzgl. Landtiere, aquatische Lebewesen und Pflanzen gemäß der Definition in Art. 3 Nr. 17 der BasisV3. Gerade in diesem Zusammenhang ist bedeutend, inwiefern die Zielrichtungen des Unionsrechts hinsichtlich ei-ner Vereinheitlichung4 gegenüber den Spielräumen der Mit-gliedstaaten für kleinere Unternehmen bzw. traditionelle Gege-benheiten und regionale Interessen abzuwägen sind. Die rechtliche Berücksichtigung von regionalen und traditionellen Gegebenheiten wird im Unionsrecht auch als Flexibilität be-zeichnet5. Die Primärproduktion ist zunächst ausgenommen von der für Lebensmittelunternehmen ansonsten essentiellen Verpflichtung zu einem auf HACCP-Grundsätzen beruhenden Risikomanagementsystem für Lebensmittelsicherheit. Jedoch wäre ein Unterbleiben jeglicher Risikokontrolle nicht vereinbar mit dem primären Normschutzziel eines hohen Gesundheits-schutzniveaus6. Demnach sind die entsprechenden Verpflich-tungen für die Primärproduktion als angemessene Kontrolle von Gefahren vorgegeben7. In diesem Zusammenhang führen z. B. die Workshops mit den Experten oftmals von Erheiterungen bis hin zu annähernden Streitigkeiten, wenn der unbestimmte Rechtsbegriff der visuellen Inspektion von Fisch bzgl. Parasiten auszulegen ist. Entsprechend geht damit einher, dass Vertreter aus Regionen mit Parasitenproblematiken eine relativ gründliche visuelle Inspektion der Fische auch für kleine Fischereifahrzeuge zwingend einfordern und das übrige Überwachungspersonal diese Anforderung etwas entspannter sieht.
Autor*in:
Stephan Ludwig
AkadVet Baden-Württemberg
Landratsamt Göppingen Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Pappelallee 10
73037 Göppingen
Telefon: 07161 202-5440
Fax: 07161 202-5490
E-Mail: veterinaeramt@lkgp.de
Illegaler Heimtierhandel und seine Auswirkungen auf deutsche Tierheime – Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre sowie Auswertung bekannt gewordener Fälle aus dem Jahr 2023
Der Deutsche Tierschutzbund wertet seit zehn Jahren die Fälle von illegalem Heimtierhandel aus, die ihm bekannt werden. Der illegale Handel insbesondere mit Hunden und Katzen hat dabei zunehmend an Bedeutung ge-wonnen. In den vergangenen zehn Jahren wurden mehr als 1.400 Fälle von illegalem Tierhandel bekannt, dabei wurden knapp 21.000 Tiere illegal transportiert! Durchschnittlich wurden demnach in den vergangenen zehn Jahren jährlich 143 Fälle von illegalem Tierhandel festgestellt. Grob überschlagen wurde etwa jeden 3. Tag ein Fall von illegalem Tierhandel in Deutschland aufgedeckt. Die durch die Corona-Pandemie geprägten Jahre 2020 und 2021 waren dabei besonders auffällig. Die Fallzahl war in die-sen beiden Jahren hoch wie nie zuvor. Seit 2022 wurde ein geringfügiger Rückgang der Fall- und Tierzahlen ermittelt. Betrachtet man die weiterhin hohen Fallzahlen in Kombination mit der gesunkenen Gesamttierzahl 2023, wird aber deutlich, dass der Handel weiterhin im großen Stil stattfindet. Anders als vor einigen Jahren werden jedoch vermehrt Einzeltiere (oder eine geringe Anzahl an Tieren) geschmuggelt und als Privatverkäufe getarnt, obwohl sich dahinter illegale und gewerbliche Absichten verbergen. Im Jahr 2023 wurden 221 Fälle von illegalem Handel mit mindestens 731 betroffenen Heimtieren und anderen Tierarten bekannt. In 88,24 Prozent der Fälle waren ausschließlich Hunde betroffen, in einem Großteil der Fälle Rassehunde. In 8,56 Pro-zent der Fälle wurden nur Katzen und in 2,26 Prozent Hunde und Katzen gemeinsam gehandelt. In nur zwei Fällen wurden andere Tierarten als Hunde und Katzen vorgefunden. Ein Großteil der Tiere (83,31 Prozent) wurde beschlagnahmt. Als Grund für eine Beschlagnahmung wurde fast immer ein Verstoß gegen das Tiergesundheitsgesetz (97,36 Prozent) angegeben. In 69,83 Illegaler Heimtierhandel und seine Auswirkungen auf deutsche Tierheime – Rückblick auf die ver-gangenen zehn Jahre sowie Auswertung bekannt gewordener Fälle aus dem Jahr 2023 Deutscher Tierschutzbund veröffentlicht seine Datenauswertung Illegal pet trade and its impact on German animal shelters – Review of the past ten years and evaluation of reported cases from 2023 German Animal Welfare Federation publishes its data analysis Prozent waren die Hunde und Katzen zu jung für einen legalen Grenzübertritt. In 87,80 Prozent der Fälle, zu denen Angaben zum Gesundheitszustand vorlagen, zeigten die Tiere Krank-heitsanzeichen, in beinahe zwei Drittel dieser Fälle litten sie an Durchfall. Die Tiere kamen überwiegend aus Rumänien, Bulgarien und Polen. Gut die Hälfte der Fälle wurde in Bayern aufgedeckt. In 97,44 Prozent der Fälle war Deutschland das Bestimmungsland. In 97,27 Prozent waren Tierheime und Auffangstationen in die Unterbringung, Pflege und Versorgung beschlagnahmter Tiere involviert. Die Kosten für die Unterbringung und Pflege eines illegal gehandelten Hundes oder einer Katze beliefen sich auf durchschnittlich 24,68 Euro pro Tier und Tag. Der 10-Jahres-Rückblick sowie die Ergebnisse 2023 machen deutlich, dass der illegale Heimtierhandel seit vielen Jahren und auch zukünftig ein großes Problem darstellt. Nach wie vor ist von einer sehr hohen Dunkelziffer auszugehen. Der Rückgang der ermittelten Zahlen ist wie auch im Vorjahr auf eine gewisse Sättigung des Marktes u.a. infolge der deutlich gestiegenen legalen sowie illegalen Importe von Hunden und Katzen in den ersten beiden Jahren der Corona-Pandemie zurückzuführen. Auch dürften die gestiegenen Kosten in allen Lebensbereichen potenzielle Interessent*innen vor dem Kauf eines Haustiers abgeschreckt haben. Deutschlandweit geraten Tierschutzvereine und Tierheime an ihre personellen und finanziellen Grenzen. Kostensteigerungen, insbesondere für Energie, Futter und tierärztliche Behandlungen, haben die Arbeit der uns angeschlossenen Vereine weiter erschwert. Gerade vor diesem Hintergrund stellt die Aufnahme illegal gehandelter Tiere eine zusätzliche und vermeidbare Belastung dar, die aus Tierschutzsicht nicht weiter geduldet werden kann. Um die Problematik des illegalen Welpenhan-dels endlich effektiv einzudämmen, müssten länderübergreifende Maßnahmen ergriffen werden – beispielsweise eine europaweite Verpflichtung zur Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen, eine gesetzliche Regulierung des Internethandels, verstärkte Aufklärung der Bevölkerung, Schulung der Polizei und des Zolls, vermehrte Kontrollen sowie härtere Strafen für Händler*innen. Auch die Einführung einer Heimtier-schutzverordnung, die u.a. einen verpflichtenden Sachkundenachweis vor Anschaffung eines Tiers enthalten sollte, sowie einer Positivliste, die festlegt, welche Tiere sich für eine Haltung in Privathand aus Tier- Natur- und Artenschutzsicht sowie aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit überhaupt eignen, könnten den illegalen Handel mit Tieren weiter einschränken. Gesetzlich bindende Regelungen zur Kostenübernahme durch die zuständigen Behörden sind ebenfalls dringend notwendig. Einen kleinen Hoffnungsschimmer bilden d-her die vorliegenden Gesetzesentwürfe der Europäischen Kommission zum Wohlergehen von Hunden und Katzen und deren Rückverfolgbarkeit sowie der Entwurf zur Überarbeitung des deutschen Tierschutzgesetzes, der erstmals in Ansätzen eine Regulierung des bislang unkontrollierten Onlinehandels mit Tieren erhoffen lässt.
Autor*innen:
Romy Zeller, Moira Gerlach, Lisa Hoth-Zimak, Henriette Mackensen, Esther Müller
Dr. Romy Zeller
Fachreferentin für Heimtiere Deutscher Tierschutzbund e.V.
Akademie für Tierschutz
Spechtstraße 1
85579 Neubiberg
Telefon: 089 600291-43
E-Mail: Romy.Zeller@tierschutzakademie.de
Alleinhaltung von Pferden ist tierschutzwidrig – ein Einzelfall mit Wirkung
In dem beschriebenen Einzelfall wird ein Kaltblutwallach ohne jeglichen Kontakt zu Artgenossen isoliert gehalten. Auf der Grundlage des § 16 a TierSchG wurde dem Tierhalter diese Haltungsform untersagt. Das Oberverwaltungsgericht hat in seinem Beschluss anerkannt, dass die isolierte Haltung eines Pferdes diesem Leiden verursacht und abzustellen ist.
Autor*in:
Dr. Anne-Kathrin Lohrenz
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395 57087 4542
E-Mail: anne-kathrin.lohrenz@lk-seenplatte.de
Die Animal Hoarding-Lage in Deutschland spitzt sich zu – Auswertung des Deutschen Tierschutzbundes für das Jahr 2023 und Vorstellung des Animal Hoarding-Projekts
Animal Hoarding beschreibt das pathologische Sammeln und Horten von Tieren in großer Anzahl. Entsprechende Fällen zeichnen sich darüber hinaus u.a. dadurch aus, dass die Versorgung und Pflege der Tiere nicht mehr ausreichend gewährleistet und Mindeststandards an eine tiergerechte Haltung nicht eingehalten werden. Dieser Artikel beschäftigt sich mit den vom Deutschen Tierschutzbund im Jahr 2023 erhobenen Daten zur Situation von Animal Hoarding in Deutschland. Mit 6.691 Tieren aus 115 Fällen wurden niemals so viele Tiere gemeldet wie im vergangenen Jahr. Dabei ist eine stärkere Fokussierung auf Hunde, Katzen und kleine Heimtiere spürbar. In knapp der Hälfte der Fälle wurden kranke Tiere gemeldet, dabei waren 209 Tiere so schwer erkrankt, dass sie später euthanasiert werden mussten. Aufgrund der hohen Dunkelziffer ist jedoch keine definitive Aussage über das genaue Ausmaß der Hoarding-Fälle in Deutschland möglich. Das Leid der Menschen und der Tiere geht in Animal Hoarding-Fällen oft Hand in Hand. Hoarder*innen sind häufig nicht fähig zu erkennen, dass sie die Tiere vernachlässigen und sie auch selber unter der Situation leiden. Da sich Betroffene mit Verlauf der Sammeltätigkeit mitunter stark von ihrem Umfeld isolieren, findet Animal Hoarding häufig im Verborgenen statt. Die Begleitumstände eines Animal Hoarding-Falls mit nicht nur zahlreichen, sondern darüber hinaus auch kranken, verhaltensauffälligen und trächtigen Tieren stellen massive Herausforderungen für alle Beteiligten dar. Nicht nur Veterinärämter und ihre Mitarbeitenden, sondern gerade auch Tierheime und ihre Mitarbeitenden geraten bei der Bewältigung eines Falls an den Rand ihrer physischen, psychischen und finanziellen Kapazitäten. Um statistisch belastbare Daten zu erheben, die Situation von Tieren in Animal Hoarding-Haltungen und die psychologischen und biografischen Hintergründe der Hoarder*innen besser zu verstehen, sowie nachhaltige Konzepte zur Prävention von Animal Hoarding zu erarbeiten, hat der Deutsche Tierschutzbund ein interdisziplinäres Forschungsprojekt ins Leben gerufen.
Autor*innen:
Nina Brakebusch, Alexandra Bläske, Christine Bothmann, Michael Christian Schulze, Sandra Wesenberg
Nina Brakebusch
Akademie für Tierschutz
Spechtstraße 1
85579 Neubiberg
E-Mail: nina.brakebusch@tierschutzakademie.de
Möglichkeiten zur Koexistenz mit dem Wolf – Aus der Sicht des Tier- und Naturschutzes, der Ökologie und der Wolfsbiologie
Im Folgenden werden die amtstierärztlichen Erfahrungen aus 17 Jahren Leben mit dem Wolf im Landkreis Lüchow-Dannenberg geschildert. Zwei Rissserien und eine wiederholte Sichtung eines Wolfes auf einem Gehöft sowie deren Ursachen und Management werden beschrieben. Daraus abgeleitet folgt im Abgleich mit überregionalen Erfahrungen eine fachliche Einschätzung der Sinnhaftigkeit der zunehmend seitens landwirtschaftlicher und jagdlicher Verbände geforderten regelmäßigen Bejagung von Wölfen (aktives Wolfsmanagement). Diese Forderung wird in der Regel mit der Verringerung von Nutztierschäden, der befürchteten Gefährlichkeit des großen Beutegreifers und dem Motiv, diesem Scheu beizubringen, begründet. Diese Argumentationskette soll hier auf den Prüfstand gestellt werden. Die Erfahrungen in Lüchow-Dannenberg entsprechen fachlichen überregionalen Aussagen. Im Ergebnis erfolgen Nutztierübergriffe durch wenige einzelne Wölfe, die Fähigkeit dazu wird nicht im Rudel weitergegeben. Herdenschutz ist wirksam und unter dem Lichte tierschutzrechtlicher Anforderungen nicht nur zumutbar, sondern bei konkreter Gefahr erforderlich und meistens auch möglich. Bejagung verspricht keine Lösung, der Wolf ist vorsichtig und hat bei fachlicher Betrachtung von Habituation und Konditionierung keineswegs „seine Scheu“ verloren. Der Wolf hat eine wichtige ökologische Funktion inne. Zur breiten Akzeptanz fehlt jedoch bisher eine zielgruppenorientierte, faktenbasierte Kommunikationsstrategie. Sie ist neben der Unterstützung der Tierhalter der wesentliche Pfeiler eines gelingenden Wolfmanagements.
Autor*innen:
Dr. Birgit Mennerich-Bunge (Dr. med. vet, Dipl. Biol., Fachtierärztin für öffentliches Veterinärwesen)
Landkreis Lüchow-Dannenberg
Königsberger Straße 10
29439 Lüchow
E-Mail: b.mennerich-bunge@luechow-dannenberg.de
Meike-Christine Karl (Dipl. Biologin, Wolfsberaterin, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin)
Am Meeschenberg 5
29456 Hitzacker
E-Mail: info@schneckenspur.de
Die Tötung tragender Nutztiere und der Umgang mit im Schlachthof geborenen Tieren
Obwohl das deutsche Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetz (TierErzHaVerbG) die Abgabe hochtragender Tiere zur Schlachtung verbietet, werden solche Tiere dennoch an Schlachthöfen angeliefert. Die Schlachtung des Muttertieres führt bei den Feten zu einer Hypoxie. Dieser Zustand ist vermutlich mit Leiden verbunden und es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis der Tod eintritt. Ein Schmerzempfinden wird bei Feten im dritten Graviditätsdrittel als wahrscheinlich angenommen, aber auch bereits ab der Hälfte der Trächtigkeit diskutiert. Folglich sollten tragende Tiere ab diesem Zeitpunkt nicht mehr geschlachtet, sondern immer euthanasiert werden. Ausnahmen im TierErzHaVerbG, die die Schlachtung tragender Tiere erlauben, sollten gestrichen werden. Immer wieder kommt es zu Geburten auf den Transporten oder im Schlachthof. Anstatt Muttertier und Neugeborene zu töten, sollte das Ziel sein, sie unter Berücksichtigung tierschutzrechtlicher Aspekte zu einem landwirtschaftlichen Betrieb zu transportieren. Ausnahmetatbestände der Viehverkehrs-Verordnung (ViehVerkV), der nationalen Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV) und der EU-Tiertransport-Verordnung (europäische Verordnung über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen, VO (EG) Nr. 1/2005) können dazu herangezogen werden.
Autor*innen:
Frigga Wirths
Referentin für Tiere in der Landwirtschaft beim Deutschen Tierschutzbund
Seybothstraße 23 b
81545 München
E-Mail: frigga.wirths@posteo.de
Katharina Hegedüsch (ORRin)
Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
Flessastraße 2
95326 Kulmbach
E-Mail: Katharina Hegedüsch@kblv.bayern.de
Dr. Rebecca Holmes
Vorsitzende des Arbeitskreises 3 „Betäubung und Tötung“ der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT)
Bergstraße 163
69121 Heidelberg
E-Mail: becx@live.de
Flughunde-Influenzavirus H9N2: Hinweise auf mögliche zoonotische Eigenschaften
Eine gerade veröffentliche Studie zeigt, dass Influenza A Virus des Subtyps H9N2 aus dem Nilflughund sich in Frettchen gut vermehrt und unter ihnen gut übertragen wird. Zudem infiziert es menschliche Lungenexplantatkulturen effizient und ist in der Lage ist, die antivirale Hemmung durch humanes MxA-Protein im Mausmodell zu umgehen.
Quelle:
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)
Südufer 10
17493 Greifswald – Insel Riems
E-Mail: internetredaktion@fli.de
Paratuberkulose: Wie aussagekräftig ist die Tankmilchuntersuchung?
Paratuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die in Deutschland meldepflichtig ist. Eine Studie des Tiergesundheitsdienstes Bayern hat auf 1.000 Betrieben verschiedene Diagnostikmethoden auf ihre Brauchbarkeit untersucht.
Autor*in:
Dr. Ingrid Lorenz
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V.
E-Mail: Ingrid.Lorenz@tgd-bayern.de
Meldepflicht von Laborverantwortlichen nach Untersuchung von Lebensmitteln bei mangelhafter Lebensmittelsicherheit
Urteil des BVerwG vom 14. Dezember 2023 (BVerwG 3 C 7.22)
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat entschieden, dass ein Laborverantwortlicher dann Grund zu der Annahme habe, dass das Lebensmittel einem Ver-kehrsverbot nach Artikel 14 Abs. 1 VO (EG) Nr. 178/2002 unterliegen würde, wenn sich aus dem Ergebnis der von dem Labor durchgeführten Analyse und gegebenenfalls weiteren Umständen ergebe, dass es voraussichtlich nicht den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit entspräche. Der Laborverantwortliche habe unter dieser Voraussetzung selbst dann die zuständige Behörde von dem Ergebnis der Analyse und deren Auftraggeber zu unterrichten, wenn das Labor die Analyse im Rahmen einer sogenannten Freigabe-untersuchung durchgeführt habe. Dies sei dann der Fall, wenn der auftraggebende Lebensmittelunternehmer das Inverkehrbringen des Lebensmittels von einer beanstandungsfreien Analyse abhängig gemacht bzw. dem Labor erkläre habe, das Lebensmittel in dem unsicheren Zustand nicht in den Verkehr zu bringen.
Autor*in:
Thorsten Bludau
Beigeordneter
Am Mittelfelde 169
30169 Hannover
Telefon: 0511 87953-21
E-Mail: bludau@nlt.de
Amtlich angeordnete Beschränkung einer Tierhaltung – VG Gießen (Az.: 4 L 840/24.Gl)
Das VG Gießen hatte sich mit Beschränkung einer Tierhaltung durch das Veteri-näramt zu befassen. Die Antragstellerin hatte bis zu 30 Tiere – Hunde und Katzen – unter sehr mangelhaften Bedingungen gehalten (Kot- und Urinverschmutzungen, massiver Geruch, nicht genügend Auslauf- und Haltungsfläche, nicht genügend Wasser etc.).
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße
961462 Königstein
Telefon: 06174 257883
Fax: 06174 257882
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
U40-Seminar 2024 des BbT – Startschuss für Weiterbildung junger amtlicher Tierärzt*innen
Nach drei sehr gelungenen Veranstaltungen in der Reihe der U40 Seminare des BbT in Fulda und Kassel findet das nächste Seminar nun am 15/16.11.2024 in der Lutherstadt Wittenberg statt.
Autor*innen:
Katharina Wadepohl, Maximiliane Puchert
Bericht über ein BTSF-Training und Aktuelles zu Lebensmittelsicherheits- und Risikobewertungen
Der Bericht fasst wesentliche Schwerpunk-te der BTSF-Schulungsreihe Lebensmittelhygiene in der Primär-produktion und des Erfahrungsaustausches im Februar 2024 in Venedig zusammen. Daneben wird auf Aktuelles im Bereich der Lebensmittelsicherheits- und Risikobewertungen2 einge-gangen. Das Kernthema der Trainings sind die Hygieneanforde-rungen an die Primärproduktion bzgl. Landtiere, aquatische Lebewesen und Pflanzen gemäß der Definition in Art. 3 Nr. 17 der BasisV3. Gerade in diesem Zusammenhang ist bedeutend, inwiefern die Zielrichtungen des Unionsrechts hinsichtlich ei-ner Vereinheitlichung4 gegenüber den Spielräumen der Mit-gliedstaaten für kleinere Unternehmen bzw. traditionelle Gege-benheiten und regionale Interessen abzuwägen sind. Die rechtliche Berücksichtigung von regionalen und traditionellen Gegebenheiten wird im Unionsrecht auch als Flexibilität be-zeichnet5. Die Primärproduktion ist zunächst ausgenommen von der für Lebensmittelunternehmen ansonsten essentiellen Verpflichtung zu einem auf HACCP-Grundsätzen beruhenden Risikomanagementsystem für Lebensmittelsicherheit. Jedoch wäre ein Unterbleiben jeglicher Risikokontrolle nicht vereinbar mit dem primären Normschutzziel eines hohen Gesundheits-schutzniveaus6. Demnach sind die entsprechenden Verpflich-tungen für die Primärproduktion als angemessene Kontrolle von Gefahren vorgegeben7. In diesem Zusammenhang führen z. B. die Workshops mit den Experten oftmals von Erheiterungen bis hin zu annähernden Streitigkeiten, wenn der unbestimmte Rechtsbegriff der visuellen Inspektion von Fisch bzgl. Parasiten auszulegen ist. Entsprechend geht damit einher, dass Vertreter aus Regionen mit Parasitenproblematiken eine relativ gründliche visuelle Inspektion der Fische auch für kleine Fischereifahrzeuge zwingend einfordern und das übrige Überwachungspersonal diese Anforderung etwas entspannter sieht.
Autor*in:
Stephan Ludwig
AkadVet Baden-Württemberg
Landratsamt Göppingen Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Pappelallee 10
73037 Göppingen
Telefon: 07161 202-5440
Fax: 07161 202-5490
E-Mail: veterinaeramt@lkgp.de
Illegaler Heimtierhandel und seine Auswirkungen auf deutsche Tierheime – Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre sowie Auswertung bekannt gewordener Fälle aus dem Jahr 2023
Der Deutsche Tierschutzbund wertet seit zehn Jahren die Fälle von illegalem Heimtierhandel aus, die ihm bekannt werden. Der illegale Handel insbesondere mit Hunden und Katzen hat dabei zunehmend an Bedeutung ge-wonnen. In den vergangenen zehn Jahren wurden mehr als 1.400 Fälle von illegalem Tierhandel bekannt, dabei wurden knapp 21.000 Tiere illegal transportiert! Durchschnittlich wurden demnach in den vergangenen zehn Jahren jährlich 143 Fälle von illegalem Tierhandel festgestellt. Grob überschlagen wurde etwa jeden 3. Tag ein Fall von illegalem Tierhandel in Deutschland aufgedeckt. Die durch die Corona-Pandemie geprägten Jahre 2020 und 2021 waren dabei besonders auffällig. Die Fallzahl war in die-sen beiden Jahren hoch wie nie zuvor. Seit 2022 wurde ein geringfügiger Rückgang der Fall- und Tierzahlen ermittelt. Betrachtet man die weiterhin hohen Fallzahlen in Kombination mit der gesunkenen Gesamttierzahl 2023, wird aber deutlich, dass der Handel weiterhin im großen Stil stattfindet. Anders als vor einigen Jahren werden jedoch vermehrt Einzeltiere (oder eine geringe Anzahl an Tieren) geschmuggelt und als Privatverkäufe getarnt, obwohl sich dahinter illegale und gewerbliche Absichten verbergen. Im Jahr 2023 wurden 221 Fälle von illegalem Handel mit mindestens 731 betroffenen Heimtieren und anderen Tierarten bekannt. In 88,24 Prozent der Fälle waren ausschließlich Hunde betroffen, in einem Großteil der Fälle Rassehunde. In 8,56 Pro-zent der Fälle wurden nur Katzen und in 2,26 Prozent Hunde und Katzen gemeinsam gehandelt. In nur zwei Fällen wurden andere Tierarten als Hunde und Katzen vorgefunden. Ein Großteil der Tiere (83,31 Prozent) wurde beschlagnahmt. Als Grund für eine Beschlagnahmung wurde fast immer ein Verstoß gegen das Tiergesundheitsgesetz (97,36 Prozent) angegeben. In 69,83 Illegaler Heimtierhandel und seine Auswirkungen auf deutsche Tierheime – Rückblick auf die ver-gangenen zehn Jahre sowie Auswertung bekannt gewordener Fälle aus dem Jahr 2023 Deutscher Tierschutzbund veröffentlicht seine Datenauswertung Illegal pet trade and its impact on German animal shelters – Review of the past ten years and evaluation of reported cases from 2023 German Animal Welfare Federation publishes its data analysis Prozent waren die Hunde und Katzen zu jung für einen legalen Grenzübertritt. In 87,80 Prozent der Fälle, zu denen Angaben zum Gesundheitszustand vorlagen, zeigten die Tiere Krank-heitsanzeichen, in beinahe zwei Drittel dieser Fälle litten sie an Durchfall. Die Tiere kamen überwiegend aus Rumänien, Bulgarien und Polen. Gut die Hälfte der Fälle wurde in Bayern aufgedeckt. In 97,44 Prozent der Fälle war Deutschland das Bestimmungsland. In 97,27 Prozent waren Tierheime und Auffangstationen in die Unterbringung, Pflege und Versorgung beschlagnahmter Tiere involviert. Die Kosten für die Unterbringung und Pflege eines illegal gehandelten Hundes oder einer Katze beliefen sich auf durchschnittlich 24,68 Euro pro Tier und Tag. Der 10-Jahres-Rückblick sowie die Ergebnisse 2023 machen deutlich, dass der illegale Heimtierhandel seit vielen Jahren und auch zukünftig ein großes Problem darstellt. Nach wie vor ist von einer sehr hohen Dunkelziffer auszugehen. Der Rückgang der ermittelten Zahlen ist wie auch im Vorjahr auf eine gewisse Sättigung des Marktes u.a. infolge der deutlich gestiegenen legalen sowie illegalen Importe von Hunden und Katzen in den ersten beiden Jahren der Corona-Pandemie zurückzuführen. Auch dürften die gestiegenen Kosten in allen Lebensbereichen potenzielle Interessent*innen vor dem Kauf eines Haustiers abgeschreckt haben. Deutschlandweit geraten Tierschutzvereine und Tierheime an ihre personellen und finanziellen Grenzen. Kostensteigerungen, insbesondere für Energie, Futter und tierärztliche Behandlungen, haben die Arbeit der uns angeschlossenen Vereine weiter erschwert. Gerade vor diesem Hintergrund stellt die Aufnahme illegal gehandelter Tiere eine zusätzliche und vermeidbare Belastung dar, die aus Tierschutzsicht nicht weiter geduldet werden kann. Um die Problematik des illegalen Welpenhan-dels endlich effektiv einzudämmen, müssten länderübergreifende Maßnahmen ergriffen werden – beispielsweise eine europaweite Verpflichtung zur Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen, eine gesetzliche Regulierung des Internethandels, verstärkte Aufklärung der Bevölkerung, Schulung der Polizei und des Zolls, vermehrte Kontrollen sowie härtere Strafen für Händler*innen. Auch die Einführung einer Heimtier-schutzverordnung, die u.a. einen verpflichtenden Sachkundenachweis vor Anschaffung eines Tiers enthalten sollte, sowie einer Positivliste, die festlegt, welche Tiere sich für eine Haltung in Privathand aus Tier- Natur- und Artenschutzsicht sowie aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit überhaupt eignen, könnten den illegalen Handel mit Tieren weiter einschränken. Gesetzlich bindende Regelungen zur Kostenübernahme durch die zuständigen Behörden sind ebenfalls dringend notwendig. Einen kleinen Hoffnungsschimmer bilden d-her die vorliegenden Gesetzesentwürfe der Europäischen Kommission zum Wohlergehen von Hunden und Katzen und deren Rückverfolgbarkeit sowie der Entwurf zur Überarbeitung des deutschen Tierschutzgesetzes, der erstmals in Ansätzen eine Regulierung des bislang unkontrollierten Onlinehandels mit Tieren erhoffen lässt.
Autor*innen:
Romy Zeller, Moira Gerlach, Lisa Hoth-Zimak, Henriette Mackensen, Esther Müller
Dr. Romy Zeller
Fachreferentin für Heimtiere Deutscher Tierschutzbund e.V.
Akademie für Tierschutz
Spechtstraße 1
85579 Neubiberg
Telefon: 089 600291-43
E-Mail: Romy.Zeller@tierschutzakademie.de
Alleinhaltung von Pferden ist tierschutzwidrig – ein Einzelfall mit Wirkung
In dem beschriebenen Einzelfall wird ein Kaltblutwallach ohne jeglichen Kontakt zu Artgenossen isoliert gehalten. Auf der Grundlage des § 16 a TierSchG wurde dem Tierhalter diese Haltungsform untersagt. Das Oberverwaltungsgericht hat in seinem Beschluss anerkannt, dass die isolierte Haltung eines Pferdes diesem Leiden verursacht und abzustellen ist.
Autor*in:
Dr. Anne-Kathrin Lohrenz
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395 57087 4542
E-Mail: anne-kathrin.lohrenz@lk-seenplatte.de
Die Animal Hoarding-Lage in Deutschland spitzt sich zu – Auswertung des Deutschen Tierschutzbundes für das Jahr 2023 und Vorstellung des Animal Hoarding-Projekts
Animal Hoarding beschreibt das pathologische Sammeln und Horten von Tieren in großer Anzahl. Entsprechende Fällen zeichnen sich darüber hinaus u.a. dadurch aus, dass die Versorgung und Pflege der Tiere nicht mehr ausreichend gewährleistet und Mindeststandards an eine tiergerechte Haltung nicht eingehalten werden. Dieser Artikel beschäftigt sich mit den vom Deutschen Tierschutzbund im Jahr 2023 erhobenen Daten zur Situation von Animal Hoarding in Deutschland. Mit 6.691 Tieren aus 115 Fällen wurden niemals so viele Tiere gemeldet wie im vergangenen Jahr. Dabei ist eine stärkere Fokussierung auf Hunde, Katzen und kleine Heimtiere spürbar. In knapp der Hälfte der Fälle wurden kranke Tiere gemeldet, dabei waren 209 Tiere so schwer erkrankt, dass sie später euthanasiert werden mussten. Aufgrund der hohen Dunkelziffer ist jedoch keine definitive Aussage über das genaue Ausmaß der Hoarding-Fälle in Deutschland möglich. Das Leid der Menschen und der Tiere geht in Animal Hoarding-Fällen oft Hand in Hand. Hoarder*innen sind häufig nicht fähig zu erkennen, dass sie die Tiere vernachlässigen und sie auch selber unter der Situation leiden. Da sich Betroffene mit Verlauf der Sammeltätigkeit mitunter stark von ihrem Umfeld isolieren, findet Animal Hoarding häufig im Verborgenen statt. Die Begleitumstände eines Animal Hoarding-Falls mit nicht nur zahlreichen, sondern darüber hinaus auch kranken, verhaltensauffälligen und trächtigen Tieren stellen massive Herausforderungen für alle Beteiligten dar. Nicht nur Veterinärämter und ihre Mitarbeitenden, sondern gerade auch Tierheime und ihre Mitarbeitenden geraten bei der Bewältigung eines Falls an den Rand ihrer physischen, psychischen und finanziellen Kapazitäten. Um statistisch belastbare Daten zu erheben, die Situation von Tieren in Animal Hoarding-Haltungen und die psychologischen und biografischen Hintergründe der Hoarder*innen besser zu verstehen, sowie nachhaltige Konzepte zur Prävention von Animal Hoarding zu erarbeiten, hat der Deutsche Tierschutzbund ein interdisziplinäres Forschungsprojekt ins Leben gerufen.
Autor*innen:
Nina Brakebusch, Alexandra Bläske, Christine Bothmann, Michael Christian Schulze, Sandra Wesenberg
Nina Brakebusch
Akademie für Tierschutz
Spechtstraße 1
85579 Neubiberg
E-Mail: nina.brakebusch@tierschutzakademie.de
Möglichkeiten zur Koexistenz mit dem Wolf – Aus der Sicht des Tier- und Naturschutzes, der Ökologie und der Wolfsbiologie
Im Folgenden werden die amtstierärztlichen Erfahrungen aus 17 Jahren Leben mit dem Wolf im Landkreis Lüchow-Dannenberg geschildert. Zwei Rissserien und eine wiederholte Sichtung eines Wolfes auf einem Gehöft sowie deren Ursachen und Management werden beschrieben. Daraus abgeleitet folgt im Abgleich mit überregionalen Erfahrungen eine fachliche Einschätzung der Sinnhaftigkeit der zunehmend seitens landwirtschaftlicher und jagdlicher Verbände geforderten regelmäßigen Bejagung von Wölfen (aktives Wolfsmanagement). Diese Forderung wird in der Regel mit der Verringerung von Nutztierschäden, der befürchteten Gefährlichkeit des großen Beutegreifers und dem Motiv, diesem Scheu beizubringen, begründet. Diese Argumentationskette soll hier auf den Prüfstand gestellt werden. Die Erfahrungen in Lüchow-Dannenberg entsprechen fachlichen überregionalen Aussagen. Im Ergebnis erfolgen Nutztierübergriffe durch wenige einzelne Wölfe, die Fähigkeit dazu wird nicht im Rudel weitergegeben. Herdenschutz ist wirksam und unter dem Lichte tierschutzrechtlicher Anforderungen nicht nur zumutbar, sondern bei konkreter Gefahr erforderlich und meistens auch möglich. Bejagung verspricht keine Lösung, der Wolf ist vorsichtig und hat bei fachlicher Betrachtung von Habituation und Konditionierung keineswegs „seine Scheu“ verloren. Der Wolf hat eine wichtige ökologische Funktion inne. Zur breiten Akzeptanz fehlt jedoch bisher eine zielgruppenorientierte, faktenbasierte Kommunikationsstrategie. Sie ist neben der Unterstützung der Tierhalter der wesentliche Pfeiler eines gelingenden Wolfmanagements.
Autor*innen:
Dr. Birgit Mennerich-Bunge (Dr. med. vet, Dipl. Biol., Fachtierärztin für öffentliches Veterinärwesen)
Landkreis Lüchow-Dannenberg
Königsberger Straße 10
29439 Lüchow
E-Mail: b.mennerich-bunge@luechow-dannenberg.de
Meike-Christine Karl (Dipl. Biologin, Wolfsberaterin, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin)
Am Meeschenberg 5
29456 Hitzacker
E-Mail: info@schneckenspur.de
Die Tötung tragender Nutztiere und der Umgang mit im Schlachthof geborenen Tieren
Obwohl das deutsche Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetz (TierErzHaVerbG) die Abgabe hochtragender Tiere zur Schlachtung verbietet, werden solche Tiere dennoch an Schlachthöfen angeliefert. Die Schlachtung des Muttertieres führt bei den Feten zu einer Hypoxie. Dieser Zustand ist vermutlich mit Leiden verbunden und es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis der Tod eintritt. Ein Schmerzempfinden wird bei Feten im dritten Graviditätsdrittel als wahrscheinlich angenommen, aber auch bereits ab der Hälfte der Trächtigkeit diskutiert. Folglich sollten tragende Tiere ab diesem Zeitpunkt nicht mehr geschlachtet, sondern immer euthanasiert werden. Ausnahmen im TierErzHaVerbG, die die Schlachtung tragender Tiere erlauben, sollten gestrichen werden. Immer wieder kommt es zu Geburten auf den Transporten oder im Schlachthof. Anstatt Muttertier und Neugeborene zu töten, sollte das Ziel sein, sie unter Berücksichtigung tierschutzrechtlicher Aspekte zu einem landwirtschaftlichen Betrieb zu transportieren. Ausnahmetatbestände der Viehverkehrs-Verordnung (ViehVerkV), der nationalen Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV) und der EU-Tiertransport-Verordnung (europäische Verordnung über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen, VO (EG) Nr. 1/2005) können dazu herangezogen werden.
Autor*innen:
Frigga Wirths
Referentin für Tiere in der Landwirtschaft beim Deutschen Tierschutzbund
Seybothstraße 23 b
81545 München
E-Mail: frigga.wirths@posteo.de
Katharina Hegedüsch (ORRin)
Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
Flessastraße 2
95326 Kulmbach
E-Mail: Katharina Hegedüsch@kblv.bayern.de
Dr. Rebecca Holmes
Vorsitzende des Arbeitskreises 3 „Betäubung und Tötung“ der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT)
Bergstraße 163
69121 Heidelberg
E-Mail: becx@live.de
Flughunde-Influenzavirus H9N2: Hinweise auf mögliche zoonotische Eigenschaften
Eine gerade veröffentliche Studie zeigt, dass Influenza A Virus des Subtyps H9N2 aus dem Nilflughund sich in Frettchen gut vermehrt und unter ihnen gut übertragen wird. Zudem infiziert es menschliche Lungenexplantatkulturen effizient und ist in der Lage ist, die antivirale Hemmung durch humanes MxA-Protein im Mausmodell zu umgehen.
Quelle:
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)
Südufer 10
17493 Greifswald – Insel Riems
E-Mail: internetredaktion@fli.de
Paratuberkulose: Wie aussagekräftig ist die Tankmilchuntersuchung?
Paratuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die in Deutschland meldepflichtig ist. Eine Studie des Tiergesundheitsdienstes Bayern hat auf 1.000 Betrieben verschiedene Diagnostikmethoden auf ihre Brauchbarkeit untersucht.
Autor*in:
Dr. Ingrid Lorenz
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V.
E-Mail: Ingrid.Lorenz@tgd-bayern.de
Meldepflicht von Laborverantwortlichen nach Untersuchung von Lebensmitteln bei mangelhafter Lebensmittelsicherheit
Urteil des BVerwG vom 14. Dezember 2023 (BVerwG 3 C 7.22)
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat entschieden, dass ein Laborverantwortlicher dann Grund zu der Annahme habe, dass das Lebensmittel einem Ver-kehrsverbot nach Artikel 14 Abs. 1 VO (EG) Nr. 178/2002 unterliegen würde, wenn sich aus dem Ergebnis der von dem Labor durchgeführten Analyse und gegebenenfalls weiteren Umständen ergebe, dass es voraussichtlich nicht den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit entspräche. Der Laborverantwortliche habe unter dieser Voraussetzung selbst dann die zuständige Behörde von dem Ergebnis der Analyse und deren Auftraggeber zu unterrichten, wenn das Labor die Analyse im Rahmen einer sogenannten Freigabe-untersuchung durchgeführt habe. Dies sei dann der Fall, wenn der auftraggebende Lebensmittelunternehmer das Inverkehrbringen des Lebensmittels von einer beanstandungsfreien Analyse abhängig gemacht bzw. dem Labor erkläre habe, das Lebensmittel in dem unsicheren Zustand nicht in den Verkehr zu bringen.
Autor*in:
Thorsten Bludau
Beigeordneter
Am Mittelfelde 169
30169 Hannover
Telefon: 0511 87953-21
E-Mail: bludau@nlt.de
Amtlich angeordnete Beschränkung einer Tierhaltung – VG Gießen (Az.: 4 L 840/24.Gl)
Das VG Gießen hatte sich mit Beschränkung einer Tierhaltung durch das Veteri-näramt zu befassen. Die Antragstellerin hatte bis zu 30 Tiere – Hunde und Katzen – unter sehr mangelhaften Bedingungen gehalten (Kot- und Urinverschmutzungen, massiver Geruch, nicht genügend Auslauf- und Haltungsfläche, nicht genügend Wasser etc.).
Autor*in:
Dietrich Rössel
Kronberger Straße
961462 Königstein
Telefon: 06174 257883
Fax: 06174 257882
E-Mail: dietrich.roessel@web.de
ANSCHRIFT
Bundesverband der beamteten Tierärzte e. V.
In der Au 1
96260 Weismain
Tel.: 0951/ 97458737
E-Mail: info@amtstierarzt.de
©2023 Bbt e.V. I Made with ♥ and ☕ by msisdesign.

ANSCHRIFT
Bundesverband der beamteten
Tierärzte e. V.
In der Au 1
96260 Weismain
Tel.: 0951/ 97458737
E-Mail: info@amtstierarzt.de

©2023 Bbt e.V. I Made with ♥ and ☕ by msisdesign.